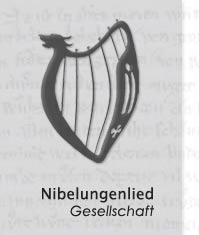|
Menschen, die an solchen Zeitfugen leben, werden zum Umdenken und Umfühlen herausgefordert, und es ist unvermeidlich, dass ganze Gruppen oder einzelne Zeitgenossen den Sprung nicht mitmachen und daran zugrunde gehen. Das geschieht in der Realität, und diese Realität findet ihre Spiegelung in literarischen Werken. Herausragende Beispiele dafür sind die Nibelungen unseres mittelalterlichen Epos und Shakespeares Bühnengestalt Hamlet. Die Entstehungsdaten des Nibelungenliedes und der Hamlet-Tragödie William Shakespeares liegen 400 Jahre auseinander: Das Epos lässt sich ungefähr auf 1200 datieren, das Bühnenstück erschien im Jahr 1600. Beide liegen an einer Zeitfuge, an einer Wende, bei der Altes zu überwinden und Neues zu bewältigen ist, und in beiden Fällen misslingt sowohl das eine wie das andere - eine durch und durch tragische Angelegenheit, wie sie sich in unzähligen Abwandlungen und Spielarten in großen und kleinen Menschenschicksalen ereignet und deshalb einen so hohen Identifikationswert aufweist. Was im Nibelungenlied geschieht, müsste besonders beim Wormser Publikum wohlbekannt sein, aber wer es nicht genau vom Text her kennt, konnte leicht durcheinanderkommen, weil die späteren Bearbeitungen des Nibelungenstoffs, die in den letzten Jahren im Umfeld des Wormser Doms zu erleben waren, zum Teil erheblich vom Epostext abweichen: zum einen das Stück von Moritz Rinke, zum anderen der Zusammenschnitt der Trilogie von Friedrich Hebbel, in dem die Vorgänge des alten Nibelungenliedes teilweise bis zur Unkenntlichkeit verändert sind. Immerhin behalten beide die wesentliche Handlungsmotivation bei: die Entwicklung zum Untergang fast aller Beteiligten. Wenn wir nun zunächst vom Untergangsszenarium im Nibelungenlied sprechen wollen, so sollten wir fragen, wo es beginnt. Nun, es wird schon in den Anfangsstrophen angekündigt, und das ganze Epos hindurch verweist der Dichter im Voraus auf das traurige Ende hin. Insofern ist es ein Untergangsstück, in dem es keine Hoffnung auf einen Ausweg gibt. Auch das erste Ereignis, das berichtet wird, besagt nichts anderes: Kriemhilds Traum spiegelt ihr Schicksal als Liebende: Der künftige Geliebte wird im Bild des edlen Falken getötet, und es nützt Kriemhild gar nichts, dass sie unter dem Eindruck dieses Traumgesichts lieber auf die Liebe zu einem Mann grundsätzlich verzichten will, als Liebesleid zu erfahren. Alle Stationen der folgenden Handlung tragen bei zur Entwicklung auf die Endkatastrophe hin. Zunächst tritt dieses Moment noch nicht deutlich zu Tage. Als Siegfried in Worms erscheint, benimmt er sich recht merkwürdig: Er fordert den König zum Zweikampf heraus, durch den darüber entschieden werden soll, wem als Sieger das Reich des Verlierers zufalle. Die völlig überraschten Burgunder haben alle Mühe, den jungen Heißsporn zur Vernunft zu bringen und ihn sein spinnig wirkendes Ansinnen vergessen zu lassen. Otfrid Ehrismann wies beim dritten Wormser Symposium zum Nibelungenlied 2001 darauf hin, dass es sich hier aber nicht um den Willkürakt eines jungen Wilden handelt, sondern um ein diplomatisches Wechselspiel zwischen Mächten, wie es sich in alten Zeiten bei Verhandlungen in der Realität als Ritual abspielte, freilich mit dem Hintergrund, dass Diplomatie leicht in kriegerische Aktion umschlagen kann. Die Burgunder können mit Klugheit und Geduld die brisante Lage ins Gleichgewicht bringen und dabei aus dem Angreifer einen Freund und Bundesgenossen machen. Es ist noch einmal gut gegangen. Bald stellt sich heraus, dass Siegfried mit einer weiteren Absicht nach Worms gekommen ist: Er will um die Hand der schönen Kriemhild anhalten. Mit der Erfüllung dieses Wunsches, der eigentlich kein Hindernis im Wege stünde, verknüpft sich aber sogleich der Werbungswunsch Gunthers, der sich im Gegensatz zu Siegfrieds Begehren als höchst problematisch erweist und damit den eigentlichen Auslösepunkt der folgenden Katastrophenreihe darstellt. Es ist der Übergriff in eine andere Sphäre. Gunther greift sozusagen nach den Sternen, wenn er die ferne Brunhild begehrt, die offenbar einem anderen Schicksal vorbehalten ist als der Ehe mit einem Durchschnittsmenschen, auch wenn er König eines Landes ist. Gleichzeitig verquickt sich damit ein anderes Moment: dass Siegfried in irgendeinem mysteriösen Verhältnis zu dieser Brunhild steht, über das sich der Nibelungendichter ausschweigt. Hebbel hat einen Zusammenhang mit dem Status einer Walküre herausgelesen. Feststeht, dass sich Siegfried nicht nur in ein Betrugsunternehmen einlässt, das irgendwann aufgedeckt und die gravierendsten Folgen haben wird, sondern dass er damit sein eigenes Persönlichkeitsbild verunglimpft und gleichzeitig die offensichtlich schicksalhaft geschützte Brunhild aus ihrem irgendwie heiligen Reservat herauszerrt und in ein unwürdiges Leben hineinzwingt. Der nächtliche Kampf im ehelichen Schlafgemach Gunthers ist ein Kampf von Giganten, bei dem Siegfried nahe am Unterliegen und hier schon vom Tod bedroht ist. Sein Sieg ist ein Scheinsieg auf dem Weg in die Katastrophe. Es erfolgt lange Zeit später der Streit der Königinnen vor dem Domportal. In einer früheren Version der Sage findet eine solche Auseinandersetzung zwischen Kriemhild und Brunhild beim Baden im Rhein statt. Brunhild schreitet im Fluss höher hinauf und deutet damit symbolisch ihren überlegenen Status als Landesherrin an mit der Folge, dass die gereizte Kriemhild sie über die wahre Rolle Siegfrieds bei ihrer Eheschließung mit Gunther aufklärt und dadurch demütigt. Diese Konfrontation verlegt der Nibelungenlieddichter aus der Naturszenerie in die einer politischen Öffentlichkeit, vor das Domportal mit dem Zerimoniell des rangabhängigen Zutritts zur Messe vor den Augen der höfischen Repräsentanten. Damit erhält die peinliche Enthüllung des Betrugs die Brisanz einer Majestätsbeleidigung höchsten Grades, verbunden mit der Entehrung und Erniedrigung einer ursprünglich im Besonderen geschützten hohen Weiblichkeit. Die Folge kann nur die Tötung dessen sein, der nicht nur die faktischen Voraussetzungen zu dieser Schmähung geschaffen, sondern seine eigene Besonderheit und Auserkorenheit verleugnet und in den Dienst eines banalen Schwindels gestellt hat. Die Ermordung Siegfrieds erschöpft sich wiederum nicht im rein Faktischen. Hagen, der von nun an mit seinem aktiven Eingreifen die Interessen des Staates im Blick hat, führt seinen Tötungsplan mit absoluter Skrupellosigkeit aus und scheut nicht davor zurück, die in tiefste Trauer gestürzte Kriemhild zu verhöhnen, indem er Siegfrieds Leichnam kaltblütig vor ihre Kemenate legt, sich ebenso kaltblütig zu seiner Mordtat bekennt und ihr schließlich durch die Versenkung des Nibelungenschatzes im Rhein rigoros die Möglichkeit nimmt, mit erkauften Helfern die Burgunder zu bedrohen. Das Bedürfnis nach Rache, das bei Kriemhild daraus erwächst, hat im Zusammenspiel nicht nur der Ereignisse, sondern auch der Verhaltensweise der Beteiligten, nicht nur Hagens, seine Ursache. Kriemhild ist Opfer einer Intrige, die ihr den Geliebten nimmt, sie ist selbst durch ihr Verhalten beim Streit am Dom daran beteiligt, und sie wird nun im weiteren Verlauf zur Täterin, die mit der gleichen Skrupellosigkeit zu Werke geht wie ihr Widersacher Hagen. Sie wird die Ehe mit dem Hunnenkönig Etzel eingehen, um sich die Machtposition zum Vollzug ihrer Rache zu schaffen, und sie wird eine Strategie der Vernichtung verfolgen, in der weder ihre Verwandten noch ihr eigenes Kind verschont bleiben. Am Ende steht eine Massentötung, bei der zwei Völker aufgerieben werden. Die Rache Kriemhilds für den Verlust ihres geliebten Gatten erreicht damit eine Dimension, die über das Persönliche und Private weit hinausgeht. Da ergibt sich nun die Frage, die im Nibelungenlied selbst nicht gestellt wird und ungelöst bleibt, worin letztlich der Sinn dieses Völkermords liegt. Der Dichter beschränkt sich darauf, die vom Unglück Betroffenen seiner Erzählung zu bedauern, er enthält sich jeden weiteren Kommentars. Das Entstehungsdatum des Nibelungenlieds lässt nun einige Gedanken dazu aufkommen. Es kennzeichnet in mehrerlei Hinsicht eine Umbruchszeit. Es bahnt sich eine Verlagerung der adeligen Burgkultur zur bürgerlichen Stadtkultur an, in der der Adel eine neue Funktion im Rahmen einer umfassender werdenden Verwaltung einnimmt. Es liegt durchaus nahe, an einen quasi nostalgischen Rückblick auf eine versinkende Zeit des edlen, heldischen Rittertums zu denken, die das Nibelungenlied feiert. An der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert ändert sich vieles. Auch auf religiösem Gebiet vollzieht sich ein Wandel, der im Kirchenbau sichtbar wird. Das mauernumhüllte romanische Gotteshaus, das vornehmlich als Klosterkirche diente, wird abgelöst von der hoch zum Himmel aufstrebenden, lichtdurchfluteten Kathedrale. Sie reißt den Gläubigen mit in eine neue Glaubensbegeisterung, die die Reste der alten heidnischen Glaubenshaltungen aufsaugt. Die neue Ära hat auch andere Leitfiguren in der Bildhauerei. An die Stelle von Kriegergestalten in voller Rüstung und mit geschlossenem Visier treten in Großplastik beispielsweise zwei Reiterstatuen: der königliche Reiter im Bamberger Dom, der in zugleich souveräner und gelöster Haltung den Zügel führt und den Blick aus einem edlen jugendlichen Antlitz in die Ferne richtet, und der Bassenheimer Reiter, der heilige Martin, der seinen soldatischen Status gegen ein ziviles Engagement eingetauscht hat, der nun nicht mehr kämpft und tötet, sondern sich mit christlicher Nächstenliebe den Bedürftigen zuwendet und damit dem Leben dient. Der rückwärts gewandte Blick des Nibelungenliedes lässt das germanische Ethos bei den Burgundern noch einmal voll in Aktion treten. Sie sind alle getauft, auch Brunhild und ihr Volk, aber diese Christianisierung erscheint nur als Tünche, unter der aber weniger die alten Götter als die alten ethischen Begriffe ihr Wesen treiben: Kampf um die Ehre und Rache für Schmach. Die Leitgedanken des Christentums: Nächstenliebe und Bereitschaft zum Verzeihen fehlen gänzlich. Vielleicht enthält an der Schwelle zu einer neuen Zeit, in der der christliche Glaube eine neue Intensität bekommt, das Nibelungenlied mit dem Untergang der Burgunder, die im alten germanischen Ethos verhaftet sind, die Botschaft, dass ein Weiterleben ohne Verzeihung und Gnade nicht mehr möglich ist, dass es nicht genügt, rein äußerlich die Taufe empfangen zu haben, ohne damit die ihr gemäße Gesinnung zu verbinden. Vielleicht haben die Zeitgenossen diesen Hinweis verstanden, weil sie selbst noch im Zwiespalt steckten und ein Exempel brauchten, um zu einer echten christlichen Gesinnung durchzufinden. Das Nibelungenlied konnte auch ohne Wink mit dem Zaunpfahl dieses Ziel erreichen eher noch als eine fromme Predigt. Nach wie vor sind wir auf die Vermutung angewiesen, dass der Autor zum Gefolge des Bischofs von Passau gehörte, dass er sicherlich ritterlicher Abstammung war und möglicherweise priesterlichen Status hatte. Daraus ließe sich die genannte Intention des Werks durchaus erschließen. Vierhundert Jahre später setzt Shakespeare seine wohl bekannteste Bühnenfigur Hamlet ebenfalls in eine Zeitfuge. Bei ihm geht es um den Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit. Das Hamlet-Stück zählt stilmäßig zum Barock, aber seinem Inhalt und seinem Anliegen nach ist es ein Renaissance-Drama. Shakespeare hat den Stoff nicht erfunden, der zurückreicht in die Zeit der Entstehung des Nibelungenliedes, er griff allerdings auf eine zeitlich nähere Bearbeitung der Sage in den Gesta Danorum, den Sagen der Dänen, des Saxo Grammaticus zurück, die er dann in seinem Sinn um- und ausgestaltete. Worum geht es nun im Shakespeareschen Bühnenwerk? Die Handlung ist zwar in Dänemark lokalisiert, aber dem Sinne nach spielt sie in der englischen Feudalwelt der Renaissancezeit. Hamlet, Prinz von Dänemark, ist aus dem Ausland zum heimatlichen Schloss Elsinor zurückgekehrt und erlebt nun, dass ihm der Geist seines toten Vaters erscheint und ihm den Auftrag erteilt, seinen gewaltsamen Tod an seinem Mörder zu rächen. In seiner Abwesenheit hat Hamlets Onkel Claudius den alten König, Hamlets Vater, umgebracht, sich selbst ohne Rücksicht auf die Erbfolge auf den dänischen Thron gesetzt und die Witwe, Hamlets Mutter, zur Frau genommen. Nach den Moralbegriffen der damaligen Zeit handelt es sich um eine Inzestehe, insofern der neue Ehemann der Bruder des vorherigen ist. Prinz Hamlet, der in Wittenberg studiert und damit den Geist der Reformation und des Humanismus in sich aufgenommen hat, sieht sich durch diese traditionelle Forderung des Vaters mit einer nicht mehr zeitgemäßen Verpflichtung konfrontiert. Daraus entsteht der Grundkonflikt, der ihn die ganze Handlung hindurch beschäftigt und tragisch untergehen lässt. Wie im Nibelungenlied zeichnet sich der Weg in die Katastrophe gleich zu Beginn der Handlung ab, wenn auch noch verdeckt. Der Zuschauer muss sich zunächst in das Wesen und Verhalten Hamlets und seiner Umgebung hineinfinden. Das erste Problem ist die Erscheinung des väterlichen Geistes. Es handelt sich dabei nicht etwa um eine Halluzination Hamlets. Andere Personen des Stücks haben vor ihm den Geist beobachtet. Dieses Handlungsmoment erweist sich als spezifisches Pänomen der Zeitfuge. Shakespeare wendet sich an ein zeitgenössisches Publikum, das auf das Erscheinen eines Geistes unterschiedlich reagieren kann. Im Volksglauben kehren Tote als Geister wieder, wenn an ihnen im Leben ein ungesühntes Verbrechen geschehen ist und dafür gesorgt werden muss, dass ihnen durch nachträgliche Sühne die Ruhe im Jenseits gewährleistet wird. Die Zuschauer können diesen Glauben teilen oder sich skeptisch bzw. ablehnend im Sinne eines neuzeitlichen Gebrauchs der Vernunft verhalten. Das fiktive Bühnengeschehen verpflichtet zu keiner bestimmten Akzeptanz. Während der Zuschauer diese Freiheit der Wahl hat, vereint Hamlet beide Haltungen in sich. Er akzeptiert spontan trotz seiner Aufgeklärtheit die Anwesenheit des Geistes und dessen Racheforderung, spottet aber dann über den „Maulwurf“ unter der Bühne, die im Shakespearschen Globe-Theater einen doppelten Boden hat, so dass dem Geist ein entsprechender Aktionsraum zugewiesen ist, und Hamlet spricht wiederum andererseits die berühmten Worte: Es gibt mehr Ding‘ im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumen lässt. Er wird sich durch alle Stationen der Handlung mit diesem Widerspruch herumschlagen, er wird die väterliche Racheforderung akzeptieren und sie gleichzeitig zurückweisen. Aus dieser Gespaltenheit ergibt sich sein berühmtes Zögern, die grundsätzliche Unentschlossenheit, wo er aktiv handeln müsste: so oder so. Und es ergeben sich daraus Ausweich- und Ersatzhandlungen, die andere und ihn selbst schließlich in den Tod reißen. Der gesamte Ablauf stellt über viele Stationen hinweg wie der des Nibelungenlieds eine Inszenierung des Untergangs in einer Endkatastrophe dar. Der Anfang der Handlung zeigt bereits eine Verflechtung von unheilträchtigen Gegebenheiten. Es wird berichtet, dass Hamlets Vater dem norwegischen Nachbarkönig Fortinbras Ländereien abgewonnen habe. Bemerkenswert ist dabei, dass dieser Streit der Könige das gleiche rituelle Grundmuster zeigt, das auch Siegfried beim ersten Auftritt am burgundischen Hof verfolgt: Die Könige entschieden im Zweikampf über Sieg und Niederlage darüber, wer das Land des Gegners gewinnen oder das eigene an diesen verlieren sollte, ohne ihre Heere einzusetzen. Dieses Verhalten hat eine lange Tradition. Das älteste deutsche Heldenlied, das um 800 aufgezeichnete, aber viel ältere „Hildebrandslied“, erzählt von der feindlichen Begegnung zweier Kampfgruppen, an deren jeweiliger Spitze Vater und Sohn, Hildebrand und Hadubrand, einander gegenüberstehen. Da der Sohn den Vater, der lange Zeit in der Ferne weilte, nicht erkennt, kann der Zweikampf nicht vermieden werden, der nun vor den Augen der harrenden Gefolgsleute erfolgt. Diesem alten, über viele Jahrhunderte gepflegten Ritual, das durch Stellvertretung von Einzelkämpfern das Opfer vieler ersparte, folgten noch der norwegische König und Hamlets Vater bei ihrer Auseinandersetzung. Für die beiden Nachfolger, den Neffen Fortinbras des alten norwegischen Königs (gleichen Namens), wie für König Claudius, den Onkel Hamlets, der seinen Bruder ermordet und dessen Thron bestiegen hat, gelten neue zeitgemäße Verhaltensregeln. Sie setzen strategisch auf den Einsatz einer perfekten Kriegsmaschinerie, die auf Massenvernichtung abzielt. Charakteristisch für die neue Zeit ist der Widerspruch zwischen der Skrupellosigkeit beim Einsatz kriegerischer Mittel und der Vernunft, mit der man auch humane Verhaltensweisen heranzieht. Hamlet sieht sich mit diesem Widerspruch konfrontiert. Nun zieht ihn das Schicksal aber in eine weitere Entscheidungsnot, die ihn unmittelbar persönlich trifft. Sein Vater erscheint ihm als Geist aus dem Totenreich mit einer Forderung, die er nicht einfach zurückweisen kann, von der er vielmehr weiß, dass sie ihm von der Tradition her als Sohn auferlegt ist. Es ist eine Racheforderung, die Aufforderung des ermordeten Vaters an den Sohn, den Mörder zu bestrafen, der ihn heimtückisch getötet hat. Gleichzeitig aber ermahnt er den Sohn, die Mutter trotz ihrer Mitschuld nicht in diese Rache einzubeziehen. Ihre Bestrafung sei Gott anheim gegeben. Auch dieses Verbot entspricht einem alten ritterlichen Ideal, das der geliebten Frau auf jeden Fall Schonung zubilligt. Hamlet, der seinen Vater zu Lebzeiten hoch verehrt und bewundert hat, ist von dieser Begegnung mit dem Geist so tief betroffen, dass er die Erfüllung der Racheforderung zu seiner Sache machen will und dies auch beschwört. Freilich kann es bei dieser ersten Reaktion nicht bleiben. Blutrache als roher Gewaltakt ist seinem Wesen nicht gemäß. Nach seinem Gespräch mit dem Geist fordert Hamlet von den Zeugen des Geschehens Stillschweigen gegenüber jedermann. Und nun beginnt ein Umschwung in seinem Verhalten: Er verhält sich widersprüchlich. Als die Vertrauten den verlangten Schweigeschwur leisten und der Geist „von unten“ diese Forderung Hamlets befürwortet, lässt Hamlet die vorher bekundete Verehrung außer Acht und nennt den väterlichen Geist „Minierer“ und „Maulwurf“. Er kündigt den verwirrten Freunden an, dass er künftig ein „wunderliches Wesen“ an den Tag legen werde. Diese Basisszene endet mit den Worten, die Hamlets Tragik fundamental zum Ausdruck bringen: Die Zeit ist aus den Fugen; Schmach und Gram, Das angekündigte „wunderliche Wesen“ wird ein vorgetäuschter Wahnsinn sein, der ein mehrfaches Ziel hat. Hamlet tarnt damit seine Pläne und Handlungen in einer Umgebung, die ihm gefährlich werden kann, und er reagiert gleichzeitig mit seiner gespielten Verrücktheit auf die wirkliche Verwirrtheit seiner Umwelt, der Welt, die „aus den Fugen ist“, und hält ihr dadurch gewissermaßen den Spiegel vor. Im Narrenkleid kann er die Wahrheit sagen. Allerdings muss er erleben, dass er damit keinen Erfolg hat, die Welt reagiert nicht im Sinne seiner Botschaften. Zum Panorama seiner Reaktionen darauf gehört auch der Gedanke, sich selbst das Leben zu nehmen, aber auch hier stößt er auf einen Widerstand, der ihn geradezu als modernen Menschen erscheinen lässt. In seinem berühmten Monolog, der mit den Worten „To be or not to be“ - „Sein oder Nichtsein“ beginnt, erwägt er diesen Gedanken, mit dem er sich zunächst eine Befreiung von all dem verspricht, was ihm zur Plage wird. Er wünscht sich den ewigen Schlaf, aber dazu tritt sofort die Assoziation des Träumens. Es ist nicht vorauszusehen, was in diesem ewigen Traum enthalten ist. Hamlet trägt in sich weder das Vertrauen der mittelalterlichen Religiösität auf einen gerechten göttlichen Richter, noch kann er glauben, dass das Individuum mit dem leiblichen Tod völlig ausgelöscht wird. Diese Ungewissheit lähmt ihn auch hier. Er zieht daraus aber die positive Schlussfolgerung, dass es darauf ankommt, in Bereitschaft zu sein, nicht resignativ, sondern hellwach zu reagieren. Es geht ihm um mehr, als nur den Gestalten, die ihn umgeben und die die Gesellschaft seiner Zeit repräsentieren, den Spiegel vorzuhalten. Sie sollen zur Besinnung gebracht werden und Konsequenzen aus ihrem Fehlverhalten ziehen. Dazu setzt er effektive Mittel ein. Er lässt eine Schauspielgruppe, die zur Unterhaltung bei Hof erscheint, eine pantomimische Szene auf seine Anweisung einstudieren und dem versammelten Hof einschließlich des Königspaares vorführen. Diese Szene stellt die Ermordung seines Vaters durch König Claudius dar, wie sie ihm der Geist des Vaters mitgeteilt hat. Damit will Hamlet dem Schuldigen indirekt zu verstehen geben, dass seine Untat nicht im Dunkeln geblieben ist. Claudius erfasst diese Botschaft Hamlets. Er zieht sich zurück zum Gebet und bekennt: O, meine Tat ist faul, sie stinkt zum Himmel; Claudius macht sich selbst nichts vor, er gesteht vor sich selbst seine Schuld ein, aber er sieht sich auch in den Widerspruch verstrickt, dass er die Tat bereut und wiederum nicht bereut, weil er auf die Früchte der bösen Tat nicht verzichten kann. So bleibt ihm nur die triviale Hoffnung: Helft,, Engel, helft ... Vielleicht wird alles gut. Während er niederkniet und sich im Gebet versucht, steht Hamlet unbemerkt hinter ihm, scheinbar bereit zur Tat, zu der er jetzt die beste Gelegenheit hätte. Aber es folgen nur Worte und Bedenken: Jetzt könnt‘ ich’s tun, bequem; er ist im Beten. Dem möglicherweise inbrünstig Betenden will er nicht die Gelegenheit verschaffen, als reuiger Sünder in den Himmel zu fahren. Hinter dieser vordergründigen Motivation verbirgt sich eine andere, die Hamlet in tieferem Sinne gemäß ist: nämlich die Blutrache in ein Selbstgericht des Schuldigen zu verwandeln und dadurch auch einen höheren sittlichen Wert im humanistisch-reformatorischen Geist der neuen Zeit zu verwirklichen, nämlich die Selbstbestimmung des freien Menschen. Freilich hat Hamlet dieses Ziel nicht klar vor Augen. Es bleibt verquickt mit der nach wie vor anerkannten Verpflichtung zur Blutrache. Sowenig Hamlet aber bereit oder fähig ist, den Racheakt zu vollziehen, sowenig ist Claudius bereit oder fähig, die erwünschte Konsequenz zum Selbstgericht zu ziehen. So schiebt Hamlet die Ausführung der Rache auf bis zu einer erhofften Gelegenheit, wo er Claudius unbedenklich zur Hölle schicken kann. Wie wenig dieser schonungsvolle Aufschub berechtigt war, zeigt sich an den Worten des Königs, als er den Betschemel verlässt: Die Worte fliegen auf, der Sinn hat keine Schwingen: Inzwischen hat ein mehrsträhniges Intrigenspiel von Seiten des Königs gegen Hamlet begonnen. Claudius hat die Gefährlichkeit seines Neffen erkannt und will ihn loswerden. Zwei ehemalige Schulfreunde Hamlets, Rosenkranz und Güldenstern, erhalten den Auftrag, Hamlet zu bespitzeln. Der Oberkämmerer Polonius hat beschlossen, Hamlet mit Hilfe seiner Tochter Ophelia, die Hamlets Geliebte ist, zu beobachten. Ein Treffen des Paares sollte belauscht und auch die Mutter in die Intrige eingeschaltet werden; sie sollte Hamlet aushorchen. Hamlet ist hellhörig genug, all diese intriganten Maßnahmen zu durchschauen. Polonius wiederum ist intelligent genug, die Gefahr in Hamlets vorgetäuschtem Irresein zu erkennen. Aus seinem Munde stammt die Bemerkung: Ist dies schon Tollheit, hat es doch Methode. Hamlet sucht seine Mutter auf, um ihr den Spiegel vorzuhalten, damit sie ihr eigenes Fehlverhalten erkennt und bereut. Der Geist des alten Königs tritt ein weiteres Mal auf und bestärkt Hamlet darin. Da aber nur Hamlet den Geist wahrnimmt und auf ihn reagiert, hält ihn die Mutter für wahnsinnig. Damit geht Hamlets Hoffnung in die Brüche, die geliebte Mutter zur wahren Selbsterkenntnis und zur aktiven Reue zu bekehren. Während des Gesprächs lauscht hinter einem Vorhang der Oberkämmerer Polonius. Als dieser die Königin in Gefahr glaubt und um Hilfe ruft, ersticht ihn Hamlet durch den Vorhang hindurch, wobei nicht eindeutig klar wird, ob er in ihm den König vermutete oder Polonius als Ersatzopfer nimmt. So ist hier in zweifacher Hinsicht die Chance zu einem sinnvollen Handeln verspielt. Das Intrigenspiel des Königs geht weiter. Hamlet soll eine Fahrt nach England antreten, angeblich um bei den Engländern, die den Dänen gegenüber in Lehenspflicht stehen, einen fälligen Tribut einzufordern. Rosenkranz und Güldenstern begleiten ihn, sie haben dem englischen Hof einen Brief zu übergeben, der die Anweisung zur sofortigen Hinrichtung Hamlets nach der Ankunft enthält. Hamlet gelingt es aber, den Spieß umzudrehen. Er bemächtigt sich auf dem Schiff heimlich des ominösen Schreibens und verändert im Text die Namen: nicht er, sondern die beiden Begleiter sollen nun in England die Delinquenten sein. Hamlet selbst gelingt es, nach Dänemark zurückzukehren. Nun stellen sich allerdings weitere Folgen auf die vorausgehenden Ereignisse ein. Laertes, der Sohn des Polonius, ist an den dänischen Hof zurückgekommen, um den Mord an seinem Vater, den Hamlet im Schlafzimmer der Mutter erstochen hat, zu rächen. Claudius sieht darin eine neue Chance, Hamlet aus dem Weg zu räumen. Er arrangiert ein Duell des Laertes mit Hamlet und stattet Laertes mit einem vergifteten Degen aus. Darüber hinaus stellt er für alle Fälle einen Becher mit vergiftetem Wein bereit. Die Königin, die mit dem König anwesend ist, trinkt im Laufe des Duells ahnungslos daraus. Hamlet wird verwundet, die Duellanten vertauschen in der Hitze des Gefechts die Rapiere, dann wird auch Laertes mit der vergifteten Waffe getroffen. Als Todgeweihter teilt er dem bisher ahnungslosen Hamlet mit, welch ein Komplott zu beider Tod geführt hat. Daraufhin streckt Hamlet auch den König nieder. Am Schluss des Nibelungenliedes und der Hamlet-Tragödie zeigt sich außer der groß angelegten Entwicklung zur Katastrophe mit einem Blutbad eine weitere Gemeinsamkeit. In beiden Handlungen steht jeweils eine gewichtige Kontrastfigur, nämlich Dietrich von Bern in der einen und der norwegische Thronfolger Fortinbras in der anderen. Die Person des Dietrich von Bern und ihre Funktion in der Handlung geben von jeher den Interpreten Rätsel auf. Es liegt nahe, in dieser Gestalt einen Repräsentanten edler humaner Gesinnung sehen zu wollen. Tatsächlich erhebt sich Dietrich über das sittliche Niveau aller anderen hinaus. Bereits bei der Ankunft der Burgunder am Hof Etzels erkennt Kriemhild, dass jemand die Eintreffenden vor ihr gewarnt haben muss, und sie droht diesem den Tod an. Darauf bekennt sich Dietrich dazu, und er fügt hinzu: „Nur zu, Teufelin (vâlandinne), du kannst mich ruhig dafür strafen!“ Im Text heißt es weiter: „Darüber schämte sich die Gemahlin Etzels sehr. Sie fürchtete Dietrich zutiefst. Da ging sie schnell von ihm, ohne ein Wort zu sagen.“ Man erfährt im Nibelungenlied nicht, in welcher Funktion und Eigenschaft Dietrich eigentlich am Hunnenhof weilt. Er ist kein Vasall Etzels, sondern selbst ein König, allerdings bezeichnet er sich als Verbannten, der offenbar hier Schutz gefunden hat. Dass ihn Kriemhild fürchtet, dürfte einerseits von diesem Sonderstatus abhängen in Verbindung mit einer moralischen Autorität, vor der sich Kriemhild duckt. Diese Integrität wird später bestätigt, als er trotz seines erfahrenen Leids - alle seine Gefolgsleute wurden von den Burgundern erschlagen, so dass nur er selbst und sein Waffenmeister Hildebrand übrig geblieben sind - Gunther und Hagen anbietet, sie als Geiseln zu nehmen und ihnen dadurch das Leben zu retten. Als die beiden aus Stolz dieses Angebot ausschlagen, ergibt sich ein weiterer Schritt in derselben Richtung: Dietrich verzichtet darauf, die Kampfesmüden, die sich aber immer noch tapfer wehren, im Kampf zu töten, er fesselt sie, um sie widerstandsunfähig zu machen. Aber nun verwickelt er sich in einen Widerspruch: Er führt sie beide vor Kriemhild, die er zwar bittet, das Leben der beiden Gefangenen zu schonen, aber wohl wissend um Kriemhilds Unversöhnlichkeit. Er zieht sich daraufhin mit Tränen in den Augen von den Helden zurück, er räumt das Feld und macht dadurch möglich, was nun geschieht: nämlich die Ermordung Gunthers und Hagens, die Vollendung der Rache Kriemhilds. Wäre Dietrich der Verfechter einer neuen humanitären Gesinnung, hätte er diesen letzten blutigen Akt verhindern müssen. Dietrich ist deshalb eher aus einer anderen Perspektive zu deuten, die einer neueren wissenschaftlichen Erkenntnis entstammt, unserem heutigen Gefühl allerdings weniger entgegenkommt. Priorität hatte für den epischen Dichter der alten Zeit nicht die psychologische Stimmigkeit einer Handlungsfigur, sondern die Folgerichtigkeit des Handlungsverlaufs auf ein festgelegtes Ziel hin. Dietrich musste dafür sorgen, dass Gunther und Hagen der unversöhnlichen Kriemhild in einer bestimmten Weise ausgeliefert wurden, nämlich lebend und wehrlos, so dass sie ihren Racheplan bis zur letzten Konsequenz durchführen konnte. Der Duktus der Handlung bestimmt also das Verhalten der Dietrich-Figur, Dietrich muss sich verhalten, wie der epische Verlauf es fordert. Der psychologische Widerspruch hat die Zeitgenossen sicherlich weniger gestört als den heutigen Leser. Bei Friedrich Hebbel, der in seiner Nibelungen-Trilogie versuchte, möglichst alle Unklarheiten und Ungereimtheiten des Epos zu beseitigen, hat sich Dietrich freiwillig, um „im Gehorsam sich zu üben“ in den Dienst des Hunnenkönigs begeben und sich mit einem Treueschwur für sieben Jahre an ihn gebunden. Hebbel lässt am Ende den völlig zerbrochenen Etzel sein Reich an Dietrich als Erbe übergeben. Und dieser übernimmt es mit den Worten: „Im Namen dessen, der am Kreuz erblich.“ Damit macht Hebbel Dietrich zu einer Trägerfigur humanistischer Gesinnung und Gesittung christlicher Prägung, womit angekündigt wird, dass eine neue Ära beginnt. In Shakespeares Tragödie erscheint am Ende auf der Bühne eine Gestalt, von der vorher nur gesprochen wurde. Der norwegische Prinz Fortinbras, der in seinem Land das Heft in die Hand genommen hat, durchzieht mit einem großen Heer Dänemark auf dem Weg nach Polen. Fortinbras ist der Mann der neuen Ära. Er hat im Gegensatz zu Hamlet ein ungebrochenes Verhältnis zu Macht und Ehre. Was Hamlet selbst nicht leisten konnte, nämlich die aus den Fugen geratene Welt einzurichten, traut er dem norwegischen Prinzen zu, wie immer der es schaffen mag - auch jetzt verlassen Hamlet seine Zweifel nicht. Als Fortinbras auf dem Plan tritt, gibt er Anweisung, die Toten in allen Ehren zu bestatten, und geht dann zur Tagesordnung über: Er tritt das Erbe des verwaisten dänischen Throns an. Wie stark und eindrucksvoll in diesem Bühnenvorgang der Einbruch eines Neuen an einer Zeitenwende zur Darstellung kommen kann, zeigte sich in der Inszenierung einer englischen Theatergruppe vor etwa vierzig Jahren. Man ließ nach dem blutigen Ausgang der Duellszene durch die hintere Kulissenwand mit Motorgedröhn die Attrappe eines Panzerwagens in den Bühnenraum hereinrollen, dem dann Fortinbras in der Uniform der alliierten Eroberer am Ende des Zweiten Weltkriegs folgte und mit souveräner Geste den humanen Akt der ehrenvollen Leichenbestattung anordnete. Von fiktiven Untergangsszenarien an geschichtlichen Wendepunkten war die Rede in meinem Vortrag, die in zwei großen Werken der abendländischen Literatur entfaltet werden. In beiden Fällen ist der Motor des unheilvollen Geschehens Rache für einen Mord, ein Urtrieb, ein atavistisches Verlangen, das im christlichen Abendland eigentlich längst überwunden sein sollte. Nun haben wir gegen Ende des 20. Jahrhunderts eine realhistorische Wende erlebt. Obwohl damals ein mächtiges Imperium zusammenbrach, geschah diese Wende im Gegensatz zu den besprochenen literarischen Vorgängen ohne blutige Inszenierung. Wir könnten uns daraufhin zu dem Schluss ermutigt fühlen, die abendländische Kulturwelt sei neuerdings nach der jahrhundertelangen Reihe von opferreichen Kriegen endlich einen Schritt weiter gekommen. Doch ließ eine neue Wende nicht lange auf sich warten: Mitten in die gerade erreichte Beruhigung nach der Beendigung der jahrzehntelangen Ost-West-Spannung und mitten in Ländern, die sich endlich zu friedlichem Zusammenleben durchgerungen hatten und sich nun außer der Reichweite von feindlichen Waffen fühlten, platzten die Sprengkörper der muslimischen Terroristen. Wieder steht dahinter nicht nur das atavistische Bedürfnis nach Rache, es stoßen hier wiederum, und zwar in einer grotesken Kombination, zwei Zivilisationsstufen aufeinander: Die Terroristen bedienen sich einer hochmodernen Technologie und folgen dabei einem wahnhaften Glaubensfanatismus, dessen Primitivität ins finstere Mittelalter zurückweist. Der Nibelungenlied-Dichter ließ in seinem Epos ein ganzes Volk untergehen, das sich einem gnadenlosen selbstmörderischen Ethos verpflichtet fühlte. Shakespeares Hamlet zerrieb sich nach dem Konzept des Autors im Widerstreit moralischer Forderungen. Die fiktionalen Handlungen der Literatur enden konsequent in einer Katastrophe, wenn die Szenerie des Ablaufs einen Ausgang im Guten ausschließt. Ob in den Vernichtungsszenarien des Terrorismus unsere in friedlicher Sicherheit geglaubte Ära untergeht oder ob uns eine unvorhersehbare neue Wende aus dieser Bedrohung rettet, wird nicht von einem Dichter nach den Regeln der Kunst festgelegt. In der Wirklichkeit des Lebens sind die Wege offen. |
|||||||