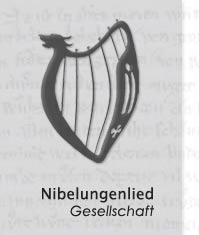|
Einst hatten die Deutschen und die Franzosen einen gemeinsamen Kaiser: Karl den Großen – in französischer Sprache Charlemagne, und seine Kaiserpfalz Aachen, französisch Aix-la-Chapelle, war Zentrum seiner Herrschaft.
Da Karl die Königsfigur des in französischer Sprache verfassten Rolandsliedes ist, muss man sich zunächst klarmachen, wie es in der geschichtlichen Entwicklung zu seiner Herrschaft über die Länder links und rechts des Rheins mit ihren unterschiedlichen Sprachen kam und was im weiteren Verlauf der Geschichte aus dieser Gemeinsamkeit geworden ist.
Die Römer besetzten unter Caesar das alte Gallien und hielten diese Herrschaft vierhundert Jahre lang. Da sie der keltischen Urbevölkerung nicht nur machtpolitisch, sondern auch kulturell überlegen waren, infiltrieren sie diese mit ihren Lebensgewohnheiten und ihrer Sprache. Die keltische Sprache der Einheimischen wurde von der römischen der Besatzer nach und nach überlagert. Es war nicht das klassische Latein der römischen Schriftsteller, sondern die Umgangssprache der Soldaten und der römischen Händler. Die ursprünglich vorwiegend bäuerlichen Gallier, die ihren Lebenshorizont unter dem Einfluss der Besatzer erweiterten, übernahmen wohl oder übel das ausdrucksreichere Vulgärlatein, wobei auch die familiäre römisch-gallische Vermischung mitgewirkt haben wird.
Als die römische Herrschaft zu Ende ging, kamen andere Eroberer aus dem Osten ins Land: die Franken. Nun geschah das Merkwürdige, dass sie nicht wie einst die Römer den Besiegten ihre Sprache aufdrängten. Die offenbar sehr anpassungsfähigen Franken übernahmen vielmehr das gallorömische Sprachgemisch der Besiegten, das ihrem mitgebrachten eigenen germanischen Idiom ebenso überlegen war wie einst das lateinische dem gallischen. Maßgebend waren dabei die Elite der Bevölkerung (Franken standen bis in hohe Positionen hinein in römischen Diensten) und der römisch orientierte, lateinisch sprechende und schreibende Klerus. Die Franken haben sich früh dem christlichen Glauben aufgeschlossen.
So bildete sich das Französische heraus, das später in Europa einmal Kultursprache Nummer Eins werden sollte, in seinem Frühstadium aber ein Gemengsel aus Vulgärlatein und immer kümmerlicher werdenden gallischen und fränkischen Sprachresten gewesen sein muss. Über Jahrhunderte hinweg läuterte sich dieses Gemisch zu der Sprache des ältesten französischen Epos hin, zur Sprache des Rolandsliedes, das dreihundert Jahre nach der Zeit Karls des Großen in altfranzösischer Sprache verfasst wurde, nämlich um 1100, hundert Jahre vor dem mittelhochdeutschen Nibelungenlied von 1200.
Auf der Herrschaftsebene waren und blieben die Franken nach ihrer Ausbreitung im ehemaligen römischen Besatzungsgebiet die Regierenden. Es regierten die Merowinger und nach ihnen die Karolinger, so genannt nach ihrem bedeutendsten Repräsentanten, Karl dem Großen.
Karl der Große baute sein Großreich vom Westen her auf. Das gallorömische Gebiet übernahm früh den christlichen Glauben. Auf dieser Grundlage konnte sich eine wesentlich solidere Herrschaftsstruktur entwickeln als im Bereich der germanischen Stämme. Karl dehnte dort mit erheblich größeren Schwierigkeiten sein Herrschaftsgebiet aus. Er eroberte nach und nach die Gebiete der bis dahin selbstständigen Völkerschaften und errichtete ein Reich, das vom Atlantik bis Österreich und von Dänemark bis Oberitalien reichte.
Die Nachkommen Karls konnten diesen Machtstatus nicht halten. Das Riesengebiet wurde im 9. Jahrhundert aufgeteilt. Nun entstanden die beiden Länder Frankreich und Deutschland, die vorher im Frankenreich vereint waren. Das Land im Westen behielt den Namen, der der alten Bezeichnung Gallien gefolgt war: Aus dem Frankenreich wurde Frankreich, die Franken wurden zu Franzosen, aus fränkisch wurde französisch. Dieser politischen Festlegung entsprach aber nicht sogleich die Namengebung bei den östlichen Gebieten. Die Bezeichnung deutsch, vormals tiusk, galt noch lange Zeit nur für die Sprache im Unterschied zum Französischen und anderen romanischen und germanischen Idiomen.
In der Folgezeit nahmen die Deutschen wie die Franzosen den Kaiser Karl als ihren großen Thronhelden in Anspruch, und das war auch gerechtfertigt, da Karl ja im noch ungeteilten Frankenreich seinen historischen Ort hatte. Die deutschen Könige wählten Aachen als Krönungsort, und Karl wurde für die Deutschen zum deutschen Kaiser. Die Formulierung, mit Karl dem Großen sei das Römische Reich deutscher Nation ins Leben gerufen worden, stammt allerdings aus einer viel späteren Zeit, nämlich aus dem ausgehenden Mittelalter. Dass die Franzosen ihren Gegenanspruch auf ihren Charlemagne gleichfalls mit voller Stimme erheben, zeigt sich gerade im Rolandslied. Hier ist Karl aus dem Blickwinkel des französischen Autors von 1100 mit allen seinen heldenhaften Kämpfern Franzose und nichts als Franzose.
Welchen Inhalt hat nun das Rolandslied?
Nachdem Karl sieben Jahre hindurch mit seinem Heer in Spanien siegreich gegen die Mauren gekämpft hat, bittet ihn der maurische König Marsilius von Saragossa um Friedensverhandlungen, allerdings mit dem Hintergedanken, sich nach Karls Abzug aus Spanien nicht an die Verträge zu halten. Karl überlegt nun, welchen seiner Getreuen er zu den Verhandlungen schicken soll, da schlägt sein Neffe Roland für diese heikle Mission Ganelon vor. Ganelon, Rolands Stiefvater, glaubt nun, Roland wolle ihn damit böswillig ins Verderben schicken, und er sinnt darauf, sich dafür zu rächen. Er erklärt sich zur Annahme des Auftrags bereit, nutzt aber die Gelegenheit, sich mit dem Maurenkönig zu verbünden.
Er schlägt Marsilius vor, die Nachhut des abziehenden Heeres, in dem sich Roland und die besten Kämpfer Karls befinden, zu überfallen. Auf dem Rückzug durch die Pyrenäen gerät dann diese Nachhut im Engpass von Roncevaux in einen Hinterhalt. Die Sarazenen brechen von allen Seiten über die Franzosen herein, und es entfaltet sich ein mörderischer Kampf. Die zahlenmäßig weit unterlegenen Helden Karls wehren sich mit höchster Tapferkeit. Olivier, Rolands Freund, rät Roland, durch ein Signal mit seinem Horn den voraus ziehenden Karl zurückzurufen, aber Roland verweigert aus heldenhaftem Stolz diesen Hilferuf trotz wiederholter Aufforderung des Mitkämpfers. Erst als es zu spät ist, gibt er nach. Karl vernimmt den Ruf des Horns, doch als er das Schlachtfeld erreicht, findet er nur noch Gefallene vor. Er schlägt die Mauren mit seinem Heer bis Saragossa zurück. Aber er muss noch einen weiteren Sieg erfechten, als Baligant, der höchste Fürst der Mauren, Marsilius zu Hilfe kommt. Mit diesem grandiosen Endsieg ist Karls spanischer Feldzug beendet. Er kehrt nach Aachen zurück, und es bleibt ihm nur noch das Nachspiel der Bestrafung Ganelons, der seinen schmählichen Verrat mit einer grausamen Hinrichtung büßt.
Die Frage ist nun, wieweit diese Geschehnisse historisch sind. Karl hat in der Tat einen Feldzug nach Spanien unternommen, um das Land von den Sarazenen zu befreien und dem Christentum zurück zu gewinnen, aber es gelang ihm nicht, Saragossa einzunehmen. Im Jahre 778 zog er sich mit seinem Heer aus Spanien zurück. Die Nachhut unter der Führung Rolands wurde im Tal von Roncevaux überfallen und vernichtet.
Der Autor weicht in mehreren Punkten von der Realität ab. In Wirklichkeit überfielen nicht die Mauren Karls Nachhut, sondern die einheimischen Gascogner, die die durchziehenden Fremden niedermachten, um sie auszuplündern. Der Erzähler des Epos schwellt dieses unspektakuläre Gemetzel zu einem großartigen Kampfgeschehen auf, in dem die fränkischen Kämpfer ihren Mut und ihre Treue zum Kaiser und ihrem Vaterland unter Beweis stellen. Roland erscheint im Epos als Karls Neffe, der er in Wirklichkeit nicht war. Schließlich endete Karls Feldzug auch nicht mit einer monumentalen Strafaktion gegen die Angreifer, die sich einfach wieder in ihrem Gebirge verloren, und es hat auch keinen großartigen Sieg über die Gesamtheit der Mauren in Spanien gegeben.
Solche stofflichen Abwandlungen der geschichtlichen Fakten sind in den Sagen und Legenden üblich, die ja in mehr oder minder großem zeitlichen Abstand von den ursprünglichen Ereignissen erzählt wurden und in denen nicht nur das Bedürfnis nach phantastischer Ausgestaltung eine Rolle spielte, sondern auch die Gelegenheit, eine großartige Vergangenheit zur Erhöhung des eigenen gegenwärtigen Prestiges ins Feld zu führen. Ein solcher Rückgriff erfolgt gerade vom 12. Jahrhundert an mit den Chansons de geste, den Epen, die Heldentaten zum Inhalt haben. Von den Heldenliedern des Sagenkreises um Karl den Großen ist das Rolandslied das bedeutendste.
In diesem Text haben wir es mit einer uns fremden Sprachform zu tun. Wie die Worte geklungen haben, wissen wir ebenso wenig wie im Falle der alten deutschen Texte. Wir können nur aus dem Schriftbild heraus die Aussprache auf Grund der Ergebnisse wissenschaftlicher Sprachforschung rekonstruieren.
Im Deutschen unterscheiden wir zwischen der althochdeutschen, der mittelhochdeutschen und der neuhochdeutschen Sprache, die natürlich gleitend von der früheren zur jeweils folgenden übergingen. Das Nibelungenlied ist in mittelhochdeutscher Sprache verfasst. Im Französischen wird nur unterschieden zwischen Altfranzösisch und modernem Französisch. Das altfranzösische Rolandslied ist für den heutigen Franzosen ebenso wenig ohne fachkundige Hilfe zu verstehen wie das mittelhochdeutsche Nibelungenlied für uns.
Carles li Reis, nostre emperere magnes ... So lauten die ersten Worte des Rolandslieds. Diese Sprachform liegt entwicklungsgeschichtlich in der Mitte zwischen dem Lateinischen und dem heutigen Französisch. Der Name Carles steht zwischen der lateinischen Wortform Carolus und der neufranzösischen Lautform Charles. Das lateinische imperator wandelte sich zu altfranzösisch emperere, und neufranzösisch empereur (Kaiser) ab, lateinisch rex, regis zu reis, dem heutigen roi (König). Das lateinische noster (unser) wurde über das altfranzösische nostre zum neufranzösischen notre, und lateinisch magnus (groß), altfranzösisch magnes, blieb im Namen Charlemagne erhalten.
Das Rolandslied ist in Versen verfasst, aber diese Verse folgen nicht unserem vertrauten deutschen Metrum, in dem betonte und unbetonte Silben wechseln. Hier werden die Silben unabhängig von ihrem Betonungsgewicht gezählt. So kommt man auf zehn Silben (ohne die Endungssilbe des Wortes am Versschluss). Die Zehnsilbler bündeln sich zu Strophen unterschiedlicher Länge, sog. Laissen. Und sie werden untereinander nicht durch Reime, sondern durch Assonanzen, also ähnlich klingende Wörter verknüpft, und alle Verse einer Strophe weisen dieselben Assonanzen auf.
Ich lese die erste Strophe im altfranzösischen Originaltext, um eine Vorstellung vom Laut- und Klangbild der Verse zu vermitteln. Freilich weiß niemand, wie sich das Gesprochene einst anhörte, zumal diese Verse in einer Art Gesang mit Saiteninstrument-Begleitung vorgetragen wurden. Zuvor in deutscher Übersetzung:
Unser großer Kaiser, König Karl,
sieben volle Jahr’ in Spanien er blieb:
Bis zur Küste gewann er das hohe Land.
Seinem Ansturm hielt keine Festung stand,
weder Stadt noch Mauern blieben verschont
außer Saragossa, hoch auf dem Berg.
Marsilius hält sie, der Gott nicht liebt,
der Mohammed dient und anfleht Apoll;
doch Unheil trifft ihn ohne Schutz und Schirm.
Carles, li Reis, nostre emperere magnes,
Set anz tuz pleins ad estet en Espaigne:
Tresqu’en la mer cunquist la terre altaigne.
N’i ad castel ki devant lui remaignet;
Murs ne citet n’i est remés à fraindre
Fors Saraguce, k’est en une muntaigne.
Li reis Marsilies la tient, ki Deu nen aimet;
Mahummet sert e Apollin reclaimet:
Ne s’poet guarder que mals ne li ataignet. (v. 1 – 9)
Diese Anfangsstrophe stellt eine musterhafte Exposition für das ganze Werk dar, indem sie die großen Handlungslinien eröffnet. Die erste Verszeile nennt die überragende Herrschergestalt: Karl der König, unser großer Kaiser. In den mittleren Zeilen ist die Rede vom siegreichen Feldzug Karls in Spanien, aber auch vom Problemfall Saragossa, das Karl als Bergfestung noch nicht einnehmen konnte. Die restlichen Verse sprechen von dem bis jetzt unbesiegten Feind Marsilius und charakterisieren ihn als einen Verwerflichen. Wenn es in der vorletzten Verszeile heißt, Marsilius diene gleichzeitig Mohammed und Apoll, so hat es damit eine für uns seltsame Bewandtnis, auf die ich später zurückkommen werde.
Nun setzt die Handlung ein. Zunächst führt der Text Beratungsszenen vor. Marsilius befragt seine Fürsten, wie er sich vor Karls Eroberungsplänen retten könne. Man rät ihm, eine völlige Unterwerfung vorzutäuschen. Die Szene wechselt nach Cordoba, wo Karl mit seinen Baronen Rat hält. Die Abgeordneten des Marsilius sind gerade eingetroffen und tragen die falschen Friedensangebote vor. Karl ist misstrauisch und berät sich mit seinen Pairs. Unter ihnen befinden sich auch Roland und sein Freund Olivier. Als Karl die Botschaft der Mauren mitteilt, meldet sich sogleich Karls Neffe Roland zu Wort und weist auf die Heimtücke des Marsilius hin, die die Franken bereits erfahren haben, und er empfiehlt, Saragossa zu stürmen. Darauf erklärt Ganelon, Rolands Stiefvater, diesen Plan für unsinnig und rät, auf Marsilius’ Angebot einzugehen. Damit treten bereits die beiden Hauptkontrahenten Roland und Ganelon einander gegenüber, und die Weichen für das Kommende sind gestellt.
Darauf schlägt der weise Baron Naimes vor, einen Unterhändler zu Marsilius zu schicken, und er erklärt sich selbst zu dieser Mission bereit, die äußerst riskant ist, weil Marsilius in seiner Willkür bereits einmal zwei fränkische Botschafter töten ließ. Karl weist aber Naimes als Gesandten zurück, den er nicht aufs Spiel setzen will. Nun stellt sich Roland spontan für dieses Unternehmen zur Verfügung, aber gleich bietet ihm sein Freund Olivier Einhalt mit der Bemerkung, Roland habe für diese diplomatische Mission ein zu heißes und wildes Herz, und er schlägt sich selbst dazu vor. Damit ist die zweite große Kontroverse angekündigt, die im späteren Endkampf den Ausschlag geben wird, nämlich die zwischen Roland und Olivier. Als noch ein weiterer Fürst zurückgewiesen wird, bringt Ronald seinen Stiefvater Ganelon ins Spiel, ohne zu ahnen, welche Folgen sich daraus ergeben.
Ganelon, der Schwager des Kaisers, wird sich als Verräter in Karls eigener Sippe erweisen. Er ist der Judas unter den zwölf Pairs, aber niemand ahnt es. Das Motiv für seinen Verrat ist Rache an Roland, von dem er glaubt, dass er ihn mit dieser gefährlichen Mission in den Tod schicken will, denn er rechnet sicher mit demselben Schicksal, wie es den beiden Vorgängern beschieden war, die Marsilius töten ließ. Er macht daraus kein Hehl und schüttet seinen Zorn über Roland, dessen Freund Olivier und alle Pairs aus, die er gegen sich verschworen glaubt. Roland lacht über Ganelons Drohung, sich an ihm zu rächen, und er erklärt sich zu dessen Beschämung noch einmal bereit, den Auftrag zu übernehmen. Aber Karl spricht sein Machtwort und trägt Ganelon seine Botschaft auf: Marsilius habe sich als Karls Vasall zu erklären und sich taufen zu lassen. Dafür bekomme er als Lehen die Hälfte Spaniens. Die andere Hälfte erhalte der Fürst Roland. Im Falle einer Weigerung werde Karl Saragossa einnehmen, Marsilius als Gefangenen nach Aachen mitführen und ihn dort zu einem schändlichen Tod verurteilen lassen.
Ganelon trifft bei Marsilius ein und schlägt sich auf dessen Seite. Er unterbreitet ihm einen perfiden Plan. Karl, sagt er, werde mit der Vorhut seines Heeres ziehen. Seine besten Kämpfer aber, Roland und Olivier, würden mit zehntausend Kriegern die Nachhut bilden. Auf diese Nachhut solle Marsilius sein gesamtes Heer ansetzen. Wenn Roland und Olivier den Tod fänden, werde Karls Mut und Tatkraft gebrochen sein, und Marsilius habe nichts mehr von ihm zu befürchten. Mit reichen Geschenken für Karl solle Marsilius’ Bereitschaft zur Unterwerfung glaubhaft gemacht werden.
Ganelon kehrt zu den Franken mit der falschen Botschaft zurück, Marsilius sei mit allem einverstanden, und löst damit Befriedigung aus. Aber damit sollte es bald vorbei sein. Als Karl das Heer zum Aufbruch aufruft und die Frage stellt, wer die Nachhut führen solle, nennt Ganelon sofort Roland als den am besten geeigneten Mann. Roland, der sich gar nicht gegen diese gefährliche Aufgabe wehrt, durchschaut aber die böse Absicht Ganelons, und er bricht in rasende Wut aus.
Die Szene schlägt zum Heereslager des Königs Marsilius um, und hier erklären die Vasallen, sich für ihren König einzusetzen. Sie treten der Reihe nach vor Marsilius und versichern übereinstimmend, ihr Schwert in Rolands Blut zu tauchen und damit den Kaiser Karl ins Mark zu treffen. Der Autor zeigt die Auftretenden trotz ihrer stereotypen Hilfezusage in einer Differenzierung, in der auch ein bisschen gallischer Humor durchscheint. Zwei von ihnen sind gemeine Schurken, aber dann treten zwei imposante Figuren auf. Vom einem, dem Emir von Balaguer, heißt es, er sei sehr schön, habe ein stolzes und offenes Gesicht, sein Mut werde weit gerühmt, und er könnte ein wahrer Fürst sein, wenn er ein Christ wäre. Ein weiterer Ausbund von Schönheit tritt auf, Margaris von Sevilla. Die Damen, heißt es, seien ihm freundlich zugetan, es gebe nicht eine, deren Gesicht bei seinem Anblick nicht aufleuchte, nicht eine, die ihm nicht unwillkürlich zulächle. Dieser Liebling der Frauen verspricht lauthals, nicht nur Roland und Olivier zu töten, er wolle dafür sorgen, dass noch vor Ablauf eines Jahres Frankreich in der Hand der Sarazenen sei.
Den Abschluss bildet dann ein wahrer Exot, der deutlich machen soll, wie weit der Machtbereich des Marsilius reicht: Es tritt auf Chernuble vom Schwarzen Tal. Sein schwarzes Haar fällt bis zum Boden, und nur zu seinem Vergnügen trägt er eine Ausrüstung mit sich, an der vier Maultiere zu tragen hätten. In seinem Land, heißt es, scheint keine Sonne, wächst kein Weizen, kein Regen fällt, und kein Tau netzt die Erde; alle Steine sind schwarz, und viele sagen, dass dort die bösen Geister wohnen. Auch er will dabei mitwirken, die Franken zu vernichten. (v. 860 ff.).
Es gehört zum Konzept der alten Epen, dass die Partei, aus deren Sicht der gesamte Erzählvorgang gestaltet ist, zwar die höchste Wertung erfährt, dass aber die feindliche Gegenpartei mit der eigenen in einem gewissen Gleichgewicht gehalten wird: Die Feinde dürfen nicht als Schwächlinge erscheinen, weil sonst die eigene Kraft und Tapferkeit nicht angemessen in Erscheinung treten könnte; sie müssen würdige Gegner sein, deren Kämpfertum Achtung verlangt. Allerdings lässt sie der Erzähler des Rolandsliedes zwiespältig erscheinen: Sie stellen ihre Qualitäten prahlerisch zur Schau, und sie werden auch in der folgenden Kampfhandlung ein ausgesprochenes Imponiergehabe an den Tag legen. Was sie aber dann zu Feinden macht, ist ihre Gesinnung, die sich in ihrem Heidentum ausdrückt, das dem missionierenden Kaiser Karl und seinen christlichen Streitern ein Gräuel ist, und in Verbindung damit ihre Aggressivität, ihre Eroberungs- und Tötungsabsicht, gegen die man sich zu wehren hat. Damit die eigene Kriegertugend in vollem Lichte steht, müssen die Feinde in zweifacher Hinsicht überlegen sein: zahlenmäßig als Übermacht und strategisch als Angreifer aus dem Hinterhalt. Erst unter diesen Gegebenheiten glänzen Roland und seine Franken mit ihrer Tapferkeit und Widerstandskraft.
Mit dem Schall von tausend Trompeten brechen die Sarazenen nach ihrer Loyalitätsbekundung gegenüber ihrem König Marsilius auf, und der Lärm ihres Anrückens ist so groß, dass ihn die Franken von weitem vernehmen. Und nun spricht Roland im Gegensatz zu den eher protzig wirkenden Reden der Maurenfürsten die bescheidenen Worte der treuen Ergebenheit:
Unsere Pflicht ist stand zu halten,
zu leiden für unseren Kaiser größte Pein,
in Hitze und in bitterem Frost
zu verlieren am Ende Haut und Haar.
Zuzuschlagen ist eines jeden Pflicht,
kein Spottlied darf über uns ertönen.
Recht ist beim Christen, beim Heiden Unrecht.
Und er fügt hinzu:
Ein schlechtes Beispiel werd’ niemals ich geben. (v. 1009 – 1016)
Der weitere Verlauf zeigt allerdings, dass sein Beispiel in einer anderen Hinsicht kein gutes ist, auch wenn er es als vorbildlich einschätzt. Von einem Hügel aus sieht Olivier die feindliche Armee heranrücken, und er erschrickt über ihre Zahl und das Ausmaß ihrer Kampfausrüstung. Es wird ihm auch gleich klar, dass die Machenschaften Ganelons im Spiel sind. Doch als er es ausspricht, verbietet ihm Roland diese Beschuldigung mit dem Hinweis, es handele sich um seinen Verwandten, obwohl er sehr wohl weiß, dass Olivier Recht hat.
Das ist aber nur der Auftakt zu einer viel folgenreicheren Zurückweisung. In realistischer Erkenntnis der gegnerischen Überlegenheit fordert Olivier Roland auf, in sein Horn zu stoßen und Karl, der mit seinem Heer noch in Hörweite ist, zurückzurufen und damit die Nachhut vor der Übermacht der Heiden zu retten. Aber da zeigt sich der Stolz Rolands, der kein Ausweichen vor dem Feind zulässt: Es bedeute Schande nicht nur für ihn selbst, sondern für alle kämpfenden Franken. Roland schätzt die Kampfbereitschaft seiner Landsleute so hoch ein, dass er einen Sieg über die zahlenmäßig noch so überlegenen Sarazenen für selbstverständlich hält. Er schlägt Oliviers Mahnung ab, er tut es dreimal, nachdem Olivier nicht nachgibt, die Vernunft sprechen zu lassen. Im Text heißt es:
Rollanz est pruz e Oliviers est sages (v. 1093)
Roland ist mutig und Olivier ist vernünftig.
Roland und Ganelon, Stiefsohn und Stiefvater, sind beide diejenigen, die die Katastrophe verursachen und herbeiführen. Der Verräter Ganelon spielt den Sarazenen die Chancen des Sieges über die Nachhut der Franken zu. Ohne seine Intrige wäre es zu diesem Kampf nicht gekommen. Roland wiederum, dem die Verantwortung für das Heil von zehntausend Kriegern anvertraut wurde, schätzt seine Aussichten, den Kampf zu bestehen, völlig falsch ein. Seine Tapferkeit artet zur Tollkühnheit aus, die ihn selbst und alle seine Kampfgenossen in den Tod reißt.
Olivier und die anderen Pairs erkennen die Aussichtslosigkeit ihres weiteren Schicksals. Es bleibt nun keine Wahl mehr. Erzbischof Turpin, der, wie es zu diesen Zeiten üblich war, als Kämpfer dabei ist, segnet nun die Franken und spendet ihnen die Absolution. „Wenn ihr sterbt, werdet ihr alle Märtyrer sein. Im Paradies sind schon die Plätze für euch bereitet.“ Im Gegensatz dazu steht, was die sterbenden Heiden zu erwarten haben: Ihre Seelen wird der Satan holen.
Die Elite der Sarazenen reitet den Franken entgegen, und alle beginnen ihre Aktivitäten mit Schmähworten, die den Zorn ihrer Gegner hervorrufen und zum Angriff anspornen. Einer nach dem anderen der heidnischen Pairs wird im Einzelkampf niedergemacht. Von den zwölf bleiben nur noch zwei, die wir von ihrem Defilee vor Marsilius kennen: Der eine ist der schöne Margaris von Sevilla, den alle Frauen verehren, der allerdings auch tapfer ist. Er hat sich Olivier als Gegner ausgesucht und hätte diesem beinahe das Leben genommen, wenn Gott nicht den Franzosen beschützt und seine Lanze an Olivier vorbei geleitet hätte, so der Erzähler.
Mit dem anderen, dem zwölften Pair, hat Roland zu tun. Es ist der langhaarige Chernuble aus dem Land, in dem alles schwarz ist, in dem keine Sonne scheint und die bösen Geister zu Hause sind. Was Roland mit ihm anstellt, ist an Grausamkeit kaum zu überbieten: Er schlägt seinen Helm in Stücke und zerteilt ihm Haar, Gesicht, das Augenpaar, Rolands Schwert fährt mitten durch seinen Leib bis in den Rücken des Pferdes, so dass Ross und Reiter zerteilt zu Boden fallen.
Man könnte der Meinung sein, die Schilderung einer solchen Bestialität sei wohl nur von einem Autor des finsteren Mittelalters zu erwarten, die in humaneren Zeiten nicht mehr vorkomme. Nun, im 19. Jahrhundert verfasste der romantische Dichter Ludwig Uhland eine Ballade mit dem Titel Schwäbische Kunde, die in alle deutschen Lesebücher aufgenommen wurde. Es ist da die Rede von einem schwäbischen Teilnehmer an Barbarossas Kreuzzug, der von einem türkischen Reiter angegriffen wird. Und da heißt es:
Da wallt dem Deutschen auch sein Blut.
Er trifft des Türken Pferd so gut,
er haut ihm ab mit e i n e m Streich
die beiden Vorderfüß’ zugleich.
Als er das Tier zu Fall gebracht,
da fasst er erst sein Schwert mit Macht.
Er schwingt es auf des Reiters Kopf,
haut durch bis auf den Sattelknopf,
haut auch den Sattel noch zu Stücken
und tief noch in des Pferdes Rücken.
Zur Rechten sieht man wie zur Linken
einen halben Türken heruntersinken.
Wie man sieht, hat sich seit dem finsteren Mittelalter bei der Schilderung ritterlicher Kämpfe nichts geändert. Nun unterhält der Autor des Rolandsliedes seine Zuhörer nicht nur mit grausigen Kampfdarstellungen. Bei aller Hektik im Wechsel von Abwehr und Gegenangriff finden die beiden Spitzenkämpfer Roland und Olivier noch Zeit zu einem Wortwechsel, der wieder einmal etwas vom gallischen Humor spüren lässt:
Während der Schlacht prescht Olivier heran. Seine hölzerne Lanze ist zerbrochen, er hält nur noch einen Teil davon in der Faust. Nun muss er noch einen Heiden namens Mausseron erschlagen. Er zerschmettert ihm den mit Gold und Vignetten verzierten Schild, er schlägt ihm beide Augen aus dem Kopf heraus, und das Gehirn des Heiden spritzt ihm vor die Füße. Kurz gesagt, er legte ihn um wie siebenhundert seiner Sippschaft. Dann tötet er Turgis und Estorgous; aber dieses Mal bricht seine Lanze ab bis zu einem Rest.
Da ruft Roland ihm zu: „Was macht Ihr, Kamerad? In einer solchen Schlacht benutzt man doch keinen Holzstock, da gibt es nichts Besseres als Eisen und Stahl. Wo ist denn Euer Schwert Hauteclaire mit dem Handschutz aus Gold und dem Griff aus Kristall?“ – „Ich hatte noch keine Zeit, es zu ziehen“, erwidert Olivier, „ich musste ja fortwährend zustechen!“ (v. 1351 – 1366)
Die Schlacht wird immer heftiger. Als der Verlust bei den Heiden in die Tausende geht, berichtet Margaris, der beinahe Olivier getötet hätte, dann aber davongeritten war, um bei König Marsilius Verstärkung anzufordern. Marsilius greift mit neuen Truppen an. Es kommt zu Zweikämpfen, bei denen Sarazenen über Franzosen siegen. Das stachelt dann wieder die Christen zum Gegenangriff an, und so geht es weiter und weiter. Marsilius verliert im Kampf mit Roland seine rechte Hand. Er flieht, als mehr als viertausend seiner Krieger gefallen sind. Die zehntausend Mitkämpfer Rolands sind bis auf sechzig getötet.
Nun endlich entschließt sich Roland, in sein Horn zu stoßen, um Karl mit dem Heer zurückzurufen. Der gewaltige Ruf ist dreißig Meilen weit zu hören. Roland platzt dabei von der Anstrengung die Schläfenader, und Blut tritt aus seinem Mund. Karl vernimmt den Hornstoß, der Verräter Ganelon an seiner Seite versucht es ihm auszureden, doch als auch die anderen das Horn Rolands vernehmen, gibt es keinen Zweifel mehr, dass die Nachhut in eine Schlacht verwickelt ist und Hilfe braucht. Und es wird allen gleichzeitig klar, dass Ganelon ihnen übel mitgespielt hat. Er wird sogleich geschoren an Kopf und Bart, erhält von jedem Faustschläge, wird dann mit Ruten und Stöcken gezüchtigt, man legt ihm wie einem gefangenen Bären eine Kette um den Hals und führt ihn zu seiner Schande auf einer Trossmähre mit.
Inzwischen ist für die restlichen Kämpfer der Nachhut ein bitteres Ende abzusehen. Olivier wird Opfer eines Lanzenstichs von hinten. Er hat gerade noch genug Kraft, um den feigen Angreifer niederzustrecken. Und nun folgt eine rührende Szene zwischen ihm und seinem Freund Roland. Der tödlich getroffene Olivier ruft Roland zu Hilfe, und als dieser herannaht, kann der blutüberströmte Olivier nichts mehr sehen, er ist geblendet. So schlägt er blind um sich, trifft den Helm Rolands und schlitzt ihn auf bis zum Nasenschutz, zum Glück ohne in Rolands Schädel einzudringen. Da schaut ihn Roland an und fragt ganz leise: „Kamerad, habt Ihr das absichtlich gemacht? Ich bin doch Roland, der Euch so sehr liebt. Ihr habt doch nichts gegen mich?“ – „Ich höre Euch“, antwortet Olivier, „ich höre Euch sprechen, aber ich sehe Euch nicht.. Ich habe Euch getroffen, verzeiht mir.“ – „Es war nicht schlimm“, entgegnet Roland. „Ich verzeihe Euch hier und vor Gott.“ Nach diesen Worten verneigen sich die beiden voreinander. (v. 2000 – 2008).
Nach dieser Geste, die eine hohe Gemütskultur erkennen lässt, stirbt Olivier, und sein Freund Roland ist so tief ergriffen, dass er nicht nur weint, sondern in Ohnmacht fällt.
Die Helden des Mittelalters können sich nicht genug tun, ihre Feinde aufs grausamste zu töten, ihnen, ohne mit der Wimper zu zucken, den Schädel zu spalten, dass das Gehirn heraus quillt, und den Bauch aufzuschlitzen, dass das Gedärm heraus bricht, aber sie weinen und werden ohnmächtig vor Schmerz über den Tod des Kampfgenossen.
Dann stürzt sich Roland ein letztes Mal auf die Feinde. Einer der wenigen, die noch übrig sind, ist der Erzbischof Turpin von Reims, auch er wird tödlich verwundet und kämpft weiter wie Roland, so dass die Heiden entsetzt fliehen. Dann bittet ihn Roland um einen letzten Gefallen: Er soll die toten Fürsten segnen. Roland trägt ihre Leichname zusammen und reiht sie vor den Erzbischof auf. Als er seinen toten Freund Olivier dazulegt, überwältigt ihn der Schmerz so sehr, dass er wiederum ohnmächtig wird. Der Erzbischof ergreift daraufhin Rolands Horn, um aus dem Bach des Tales Wasser zu holen, aber er ist bereits zu geschwächt und bricht nach wenigen Schritten tot zusammen.
Und nun ist es an Roland zu sterben. Als er am Boden liegt, nimmt ihn ein Heide wahr und will sein berühmtes Schwert Durendal an sich reißen. Da bäumt sich Roland ein letztes Mal sich auf und erschlägt mit seinem Horn den Vorwitzigen. Daraufhin versucht er mehrmals vergebens sein Schwert, in dessen Griff Reliquien eingearbeitet sind, an einem Felsen zu zerbrechen, damit es nicht in Hände von Heiden fällt. Schließlich verlässt ihn seine Seele. Der Erzengel Gabriel nimmt sie in Empfang, begleitet von Sankt Raphael und Sankt Michael, und trägt sie in das Paradies.
Als Kaiser Karl auf dem Schlachtfeld eintrifft, findet er nur Erschlagene vor, und seine Klage ist bitter. Er muss aber die Toten zunächst liegen lassen und die Sarazenen verfolgen, um Rache zu nehmen. Dabei lässt Gott ein Wunder geschehen. Damit erreicht der Geist der christlichen Mission, unter dem die gesamte Handlung steht, ihren Gipfel. Die Sonne bleibt so lange am Himmel stehen, bis Karl sein Rachewerk vollzogen hat. Dieses Wunder ist angelehnt an den biblischen Bericht von der Schlacht gegen die Amoriter, in der Josua, der Anführer der Israeliten, anfleht:
„Sonne, stehe still zu Gibeon,
und Mond im Tal von Ajalon!“
Da stand die Sonne still,
und der Mond blieb stehen,
bis das Volk Rache genommen
an seinen Feinden.
(Josua 10, 12 f.)
Kaiser Karl wird durch diesen biblischen Anklang auf die höchste religiöse Stufe gestellt. Er ist wie Josua ein Streiter im Auftrag Gottes, der eindeutig und ausschließlich auf der Seite der christlichen Franken steht. In Saragossa aber rechnen die zurückgeschlagenen Heiden ab mit ihren Idolen, die ihnen nicht geholfen haben, sondern sie in Schande geraten ließen. Es war bereits in der ersten Strophe von ihnen die Rede. Die Enttäuschten entreißen Apoll Zepter und Krone, treten ihn mit Füßen und schlagen ihn mit Stöcken in Stücke. Mohammed werfen sie in einen Graben, wo ihn Schweine und Hunde beißen und auf ihm herumtrampeln.
Marsilius wird aber nicht rasten und ruhen, bis er erneut gegen Karl ziehen kann. Diesmal setzt er den mächtigsten Mann der arabischen Welt unter Druck mit der Drohung, er werde sich taufen lassen, wenn ihm der Emir Baligant mit seinem mächtigen Heer und seiner Flotte nicht zu Hilfe komme. Dieser verspricht Marsilius, die verlorene rechte Hand, die Roland ihm abgeschlagen hat, durch das Haupt des Kaisers Karl wettzumachen.
Inzwischen hat Karl das Leichenfeld seiner Nachhut wieder erreicht. Mit unendlicher Trauer sieht er seine Elite am Boden, und er macht sich auf die Suche nach dem Leichnam seines Neffen Roland. Er findet die Steine, an denen Roland sein Schwert zerbrechen wollte, und dann Roland selbst: Er liegt, das Angesicht den fliehenden Feinden und dem Land zugewandt, das er als Kämpfer Karls erobert hat, ein Sieger auch noch im Tode. Der Kaiser lässt die gefallenen Franzosen feierlich beerdigen, die Körper Rolands, Oliviers und des Erzbischofs Turpin lässt er öffnen und die Herzen herausschneiden, um sie in die Heimat mitzuführen.
Kaum ist dieses heilige Amt vollzogen, treffen die Gesandten des Emirs ein, um Karl den Kampf anzusagen. Karl bricht nun mit seinem Heer auf, um auch diesen letzten Akt auf spanischem Boden zu vollziehen. Die Schlacht zieht sich lange hin und endet erst, als in einem Zweikampf Karl selbst den Emir getötet hat. Bei der Nachricht vom Tod der Emirs bedeckt der König Marsilius sein Gesicht, bricht in Tränen aus und stirbt vor Schmerz. Nun sind die Mauren endgültig besieht, und Karl kann kampflos die Stadt Saragossa in Besitz nehmen.
Was nun geschieht, ist für uns heute ein Gräuel, für den mittelalterlichen Erzähler wie auch für seine Zuhörer aber eine Selbstverständlichkeit. Tausend Franzosen eilen auf Befehl des Kaisers in allen Richtungen durch die Stadt Saragossa, dringen in die Moscheen und die Synagogen ein und zerschlagen mit Hämmern und Äxten das Bild Mohammeds und alle Götzenbilder, so dass keine Spur von ihnen übrig bleibt. Die Bischöfe in Karls Heer treiben die Heiden zur Zwangstaufe. Wer von ihnen sich widersetzt, wird erhängt, erschlagen oder verbrannt. Mehr als hunderttausend Heiden wurden wahre Christen (veir chrestien), sagt der Autor. Die Königin Bramimonde lässt Karl als Gefangene nach Frankreich mitführen, wo sie zum Christentum bekehrt werden soll.
Die Gemahlin des Königs Marsilius hat weiter keine Funktion in der Handlung, sie erscheint nur, um durch ihre Taufe den höchsten Triumph des Christentums am Ende des Machtkampfs auszudrücken. Ein zweites weibliches Wesen wird mitten im Kampfgetümmel in zwei Zeilen erwähnt. Olivier nennt den Namen seiner Schwester Alde und deutet an, dass Roland mit ihr liiert ist (v. 1720 f.). Roland verliert dazu kein Wort. Als Karl nach Aachen zurückgekehrt ist, erfährt diese Alde vom Tod ihres Verlobten, und ihre Empfindung über diesen Verlust ist so stark, dass sie auf der Stelle stirbt (v. 3720 f.) Der sterbende Roland hingegen äußert keinen Gedanken an seine Braut. Die Seelen aller Helden Karls sind ausschließlich erfüllt von der Liebe zum Vaterland. La douze France, das liebliche Frankreich ist das Ziel all ihrer Wünsche, und nur der mitkämpfende Gesinnungsgenosse ist für sie präsent.
Am Anfang der französischen Literatur, die in der Folgezeit die Frauenverehrung zu ihrem großen Thema macht (man denke an die Liebeslieder der Troubadoure) und damit für die Nachbarkulturen, im Besonderen für den deutschen Minnesang, zum Vorbild wird, am Anfang dieser französischen Literatur steht ein reines Männerstück, in dem Frauen keine Rolle spielen.
Das Ethos der männerbezogenen Dichtung verlangt am Ende die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen einem unerhörten Verbrechen und einer drastischen Sühne. In Aachen wird dem Verräter Ganelon der Prozess gemacht. Dessen Verwandte haben sich um den Gefangenen versammelt, um sich mit Hinweis auf seine vorherigen Verdienste für seine Begnadigung einzusetzen. Schließlich wird der Rechtsfall durch einen Zweikampf entschieden: Ein Vertreter der Anklage besiegt einen der Verteidiger. Daraufhin wird Ganelon gevierteilt, aber das genügt nicht als Gegengewicht zum Tod der Opfer des Verrats: Alle Verwandte, die sich durch ihren Einsatz für Ganelon mitschuldig gemacht haben, werden erhängt.
Doch damit klingt das Rolandslied noch nicht aus, es folgt am Ende eine kleine Nachricht, von der man nicht recht weiß, ob man nicht wieder ein Stückchen gallischen Humor darin vermuten soll: Als die Nacht hereinbricht und Karl in seinen verdienten Schlaf sinken will, steigt der heilige Gabriel zu ihm herab und teilt ihm im Auftrag Gottes mit:
„Karl, Karl, sammle die Heere deines Reiches, marschiere eilends nach Bire, um dem König Vivian in Imphe zu Hilfe zu kommen. Diese Stadt belagern die Heiden, und die Christen rufen laut nach dir.“
Der Kaiser Karl aber möchte am liebsten gar nicht dorthin marschieren, wo immer dieses Land und diese Stadt mit ihrem König zu suchen wäre.
„Deus!“ dist li Reis, „si penuse est ma vie!
Pluret des oilz, sa barbe blanche tiret “ (v. 4001 f.)
„O Gott!“, sagt der König, „wie ist mein Leben strapaziös!“
Er weint und rauft seinen weißen Bart.
Nach all dem bisher Gesagten drängt sich nun ein Vergleich mit unserem Nibelungenlied auf. Es dürfte deutlich geworden sein, dass ein Hauptunterschied in der religiösen Auffassung liegt. Das Rolandslied ist von einem ausgeprägten christlichen Geist durchdrungen. Charlemagne ist der von Gott berufene Verteidiger des Christentums. Er steht mit Boten des Himmels, den Erzengeln, in Verbindung. Seine Kämpfer sind sich der ewigen Seligkeit sicher. Auf ihrer irdischen Heimat, der douze France, dem lieblichen Frankreich, ruht der liebevolle Blick Gottes. Sie zweifeln keinen Augenblick daran, dass die Vernichtung der Heiden Gottes Wille und ihr kämpferischer Beitrag dazu das Höchste ist, das sie leisten können.
Das Bild der Feinde des Christentum, die einfach als Heiden bezeichnet werden, ist aus unserer Sicht geradezu grotesk. Es setzt beim Autor eine Reihe von sicherlich zeit- und situationsspezifischen Kenntnislücken voraus. Er weiß nichts von der Glaubenswelt des Islam: vom Bilderverbot, demzufolge es undenkbar ist, dass es von Mohammed eine Statue gibt, die angebetet wird, und gleichzeitig eine griechische Götterstatue neben Mohammed! Vielleicht steht dahinter eine Ahnung beziehungsweise eine abstrus entstellte Nachricht von der hohen Wissenskultur der Araber, deren Gelehrte zur Zeit Karls des Großen längst alle Schriften der griechischen und römischen Antike in ihre Sprache übersetzt und die dort vorgefundenen Wissenschaften selbständig weiterentwickelt hatten, so dass das Abendland weitgehend seine Kenntnis der Antike und eine Reihe von fundamentalen Erkenntnissen auf mehreren Wissenschaftsgebieten den Arabern verdankt. Im 12. Jahrhundert wird, vielleicht noch zur Lebenszeit des Rolandlied-Autors, ein im maurischen Spanien lebender arabischer Gelehrter namens Averroes die Werke des Aristoteles kommentieren und für die Philosophen des damaligen Abendlandes als Vorbild gelten. Andererseits hat die Naivität des altfranzösischen Eposschreibers keineswegs die Beliebtheit und Ausbreitung des Rolandsliedes behindert.
Das Nibelungenlied beruht auf ganz anderen geistigen Grundlagen. Obwohl die Handlungsträger alle getauft sind und die Messe im Wormser Dom besuchen, ist von einer Auswirkung davon auf ihr Denken, Fühlen und Tun nichts zu merken. Sie stehen noch im Banne des alten germanischen, eines heidnischen Ethos. Das Verhalten der Männer wird weitgehend bestimmt durch Gefolgschaftstreue gegenüber dem Königshaus und sich selbst genügende Kampfbereitschaft. Die Dänen und die Sachsen, die die Burgunder angreifen, werden nicht als Glaubensfeinde besiegt, sondern als Völkerschaften, die ihnen rein machtpolitisch gefährlich werden könnten. Und schließlich findet im Grunde dieser Krieg im Zusammenhang der Handlung statt, damit sich der gerade ins Worms eingetroffene Siegfried als Freund der Burgunder und Freier der Kriemhild bewähren kann.
Die Frauen, die es als Handelnde im Rolandslied nicht gibt, erweisen sich im Nibelungenlied als die Handlungsauslösenden. Brunhilds Demütigung durch Siegfried und Kriemhild sowie Kriemhilds Verlust des geliebten Gatten rufen je eine Rachehandlung hervor, die in Kombination miteinander zu einem Völkermord eskalieren.
Die Grundemotion, die beide Handlungen mitbestimmt, ist die Rache. Im Rolandslied ist sie Teil des Vernichtungsauftrags, wie die Franken ihn im Glaubenskampf verstehen. Die jesuanische Botschaft, die eigentlich Grundlage christlicher Gesinnung sein soll, nämlich die Forderung der Nächstenliebe, die auch die Feindesliebe einschließt, ist völlig ausgeblendet. Im Nibelungenlied ist die Rache sogar persönliche Verpflichtung: Kriemhild muss den Mord an ihrem Gatten rächen, da keiner ihrer Verwandten diese Aufgabe übernehmen kann. Auch und gerade hier haben Verzeihen und Gnade keinen Platz. Im hundert Jahre früheren Rolandslied feiert das Christentum Triumphe, die uns heute recht fragwürdig scheinen, im Zeitgeist des frühen Mittelalters aber Vorbildliches repräsentieren. Das Nibelungenlied entsteht in der Blütezeit des christlichen Rittertums, aber die gleichzeitig laufenden Kreuzzüge der Ritter lassen mit ihren Grausamkeiten das Prädikat christlich höchst fragwürdig erscheinen.
Wie beim Nibelungenlied sind wir beim französischen Werk neugierig auf den Autor. Da steht zwar am Ende des Textes die Bemerkung: Ci falt la Geste que Turoldus declinet. = Hier schließt die Heldensage des Turoldus, wobei das letzte Wort des Satzes declinet vielerlei bedeuten kann. Dieser Turoldus kann der Autor oder ein Bearbeiter des Stoffes sein. Die Namensangabe gibt auch keinerlei Auskunft über die Person. So bleibt nur die enttäuschende Feststellung, dass der Autor des Rolandsliedes ebenso unbekannt ist wie der des Nibelungenliedes. Man versucht ihn wenigstens zu lokalisieren, ist sich aber auch darüber in der Fachwelt nicht einig. Die einen suchen ihn in der Normandie, die anderen in der Ile-de-France, also im Pariser Raum.
Die Handschrift, die unter mehreren als die zuverlässigste gilt, wird in Oxford aufbewahrt und danach auch benannt. Sie umfasst 4002 Verse. Die Entstehungszeit wird mit etwa 1100 angegeben. Eine genauere Bestimmung ist nicht möglich. Obwohl der erste Kreuzzug von 1096 in zeitlicher Nähe liegt, ist davon im Epos nichts angedeutet. Das Rolandslied ist eher im Zusammenhang der seit Jahrzehnten laufenden Reconquista zu sehen, der Wiedereroberung Spaniens mit der Vertreibung der Araber aus Spanien. Der überlieferten Endfassung dürften viele Vorstufen noch weitab von den Kreuzzügen vorausgegangen sein.
Ursprünglich wurden wohl vom Volk Lieder über den Helden Roland und seinen tragischen Tod in den Pyrenäen gesungen, dann griffen berufliche Erzähler, so genannte Jongleure, Spielleute, die vorhandenen Teilsagen auf und formten sie zu Heldengesängen, den Gestes, Tatenliedern, bis schließlich nach einer Jahrhunderte langen Anlaufzeit der Künstler auftrat, der dem Stoff die uns vorliegende Fassung gab. Das hypothetische Entstehungsdatum um 1100 liegt also rund hundert Jahre vor dem ebenso vermutlichen Entstehungsdatum des Nibelungenliedes.
Unser Interesse gilt aber nicht nur dem Epos selbst, sondern auch der Frage, wie die Folgezeit, die Nachwelt mit ihm umgegangen ist, d.h. der Frage nach der Wirkungsgeschichte. Da lässt sich zunächst sagen, dass es von den Völkern ringsum in kaum abschätzbarem Maße aufgenommen, in die jeweiligen Sprachen übertragen und bearbeitet wurde. In Deutschland übersetzte um 1170 der aus Regensburg stammende Pfaffe Konrad das altfranzösische Original ins Lateinische und lieferte dann eine deutsche Version mit Abwandlungen. Ich greife aber lieber ein viel späteres Dokument der Rezeptionsgeschichte auf, das in einer brisanten Epoche der französisch-deutschen Nationenfeindschaft eine Rolle spielte.
Nachdem der Text des Rolandlieds in der Romantik, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, entdeckt worden war, widmete sich ein französischer Gelehrter namens Léon Gautier seiner Erschließung. Er besorgte eine kritische Ausgabe, und es ging ihm dabei um mehr als um eine wissenschaftliche Bearbeitung. Das Buch, für das er auf höchster Ebene preisgekrönt wurde, trägt den Titel: LA CHANSON DE ROLAND, texte critique, traduction et commentaire, grammaire et glossaire, par Léon Gautier, membre de l’Institut. Ouvrage couronné par l’Académie Française et par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Edition classique à l’usage des élèves de seconde
Die mir vorliegende achte Auflage ist undatiert. Es geht allerdings aus einer Bemerkung innerhalb des Textes hervor, dass sie um 1885 erschienen sein dürfte. Worauf es hier ankommt: Es ist die Zeit zwischen dem Krieg von 1870/71 und dem Ersten Weltkrieg. Das Buch spiegelt in ausgeprägter Weise die atmosphärische Auswirkung des gegen die Deutschen verlorenen Krieges. Léon Gautier bemüht sich, seinen Landsleuten, den Schülern der gymnasialen Oberstufe und ihren Lehrern, bewusst zu machen, welch ein bedeutendes Dokument einer großartigen französischen Vergangenheit das Rolandslied darstellt. Und er richtet den Blick dabei nach Deutschland:
Wenn Deutsche diese Seiten lesen, so mögen sie meine folgenden Worte wohl bedenken. Es ist vom 11. Jahrhundert die Rede. Diejenigen, die heute mein armes Frankreich bedrohen, weise ich mit vollem Recht darauf hin, wie groß es vor etwa achthundert Jahren war.
Und da sie davon reden, das Reich Karls des Großen wieder auferstehen zu lassen, so füge ich mit Freuden hinzu, dass es niemals eine Darstellung Karls gegeben hat, die man mit der unseres französischen Dichters gleichsetzen kann. Die jenseits des Rheins haben über ihn ein paar geistlose Märchen ausgedacht, Hirngespinste ohne Grundlage, ohne Größe. Der wahre König Karl ist im Rolandslied zu finden.
Gautier zählt nun die wundervollen Eigenschaften Karls auf, die im Rolandslied in Erscheinung treten, und er fasst zusammen: Karl sei hier noch der germanische König, aber auch der katholische Kaiser. Und, umgeben von all seinen beherrschten Völkerschaften, ruhe sein zärtlichster Blick auf den Franzosen. Diese wiederum repräsentieren nach Gautier alle Gefühle, alle Kräfte der menschlichen Seele. Roland, das ist der unbeherrschte, tollkühne, großartige, mit einem Wort: französische Mut. Olivier, das ist der Mut mit Besonnenheit, der durch Mäßigung Erhabenheit erreicht. Ganelon ist nicht etwa der geborene Verräter, er ist der gefallene Mensch, der, ursprünglich tapfer und treu, von seiner Leidenschaft überwältigt wird. Auf diese einfühlsame Weise versucht Léon Gautier seinen Landleuten das Epos nahe zu bringen. Er weiß, dass der Text den Franzosen seiner Zeit Schwierigkeiten bereitet, denn sie sind geschult an den rhetorisch überlegenen Werken der Antike und der französischen Klassik, gegen deren Eleganz die frühe Sprache und Form des Rolandsliedes noch unbeholfen wirkt. Für diese konventionelle Einstellung gibt ein berühmtes Beispiel in der Wirkungsgeschichte des Nibelungenliedes: Friedrich der Große, Verehrer der französischen Klassik und Rokoko-Dichtung, in der er sich selbst in französischer Sprache versuchte, wusste mit dem deutschen Epos ebenso wenig anzufangen wie die Franzosen mit dem Rolandslied. Er erachtete „dergleichen elendes Zeug nicht einen Schuss Pulver werth“.
Bei der Rede an seine Landsleute weist Léon Gautier mit aller Dringlichkeit darauf hin, dass die Beschäftigung mit diesem Basiswerk französischer Geistigkeit eine Möglichkeit zur Rettung aus der nationalen Depression bietet, in der sich die Franzosen nach dem verlorenen Krieg befanden. Er tut alles, um das Jahrhunderte lang unbeachtete, ja missachtete Epos zum französischen Nationalepos werden zu lassen. Dessen Helden, sagt Gautier, lassen mit jedem Wort und jeder Geste eine Liebe zu Frankreich und ihrem französischen Kaiser erkennen, an dem sich die Franzosen der Neuzeit ein Beispiel nehmen können. Immer wieder ist darin von la douce France die Rede, dem süßen, dem lieblichen Frankreich, das man gar nicht zärtlicher benennen könnte. Mit diesem Wort auf den Lippen sterben die Helden, und König Karl ist mit seiner ganzen Gestalt der geliebte und zutiefst verehrte Repräsentant dieser innigen Liebe zum Vaterland Frankreich.
Von dieser Lobpreisung französischen Edelmuts schlägt Léon Gautier einen großen Bogen über acht Jahrhunderte hinweg und beschließt seine Einführung in das verehrte Epos mit den Worten: Nichts ist aktueller als dieses Heldenlied, denn was ist es anderes als der Bericht über eine große Niederlage Frankreichs, für die aber Frankreich ruhmvoll Rache genommen hat.
Eine Niederlage haben wir ebenfalls erlebt, und wir werden sie eines Tages durch einen großen und schönen Sieg vergelten. Léon Gautier war es nicht vergönnt, diesen „großen und schönen Sieg“ zu erleben, er starb zwei Jahrzehnte vor dem Ende des Ersten Weltkriegs, der mit dem Vertrag von Versailles Frankreich die ersehnte revanche bescherte. Nun jedoch wurden im besiegten Deutschland ähnliche Wünsche nach Vergeltung laut, wie sie Gautier geäußert hatte. Als die Franzosen unser westliches Gebiet als Besatzungsmacht in ihre Regie übernahmen, geschah manches Unerfreuliche, aber es ist auch Gegenteiliges zu berichten.
André Soutou, Agrégé de l’Université (a. o. Professor), der von der französischen Militärregierung in unserem Raum mit der Überwachung des Erziehungswesens im Zuge der Entnazifizierung betraut wurde, hat Worms mit seiner reichsstädtischen Vergangenheit hoch geschätzt, und er war begeistert vom Nibelungenlied, über das er vor französischen Amtsträgern des Mainzer Distriktes einen umfangreichen Vortrag hielt. Darin fällte er, en passant als Einschub formuliert, folgendes bemerkenswerte Urteil:
'la grande chanson de geste du peuple allemand, l’équivalent et plus que l’équivalent de notre Chanson de Roland“ = das große deutsche Heldenlied, das unserem Rolandslied ebenbürtig, ja mehr als ebenbürtig ist “
Damit sprach ein französischer Literaturkenner vor seinen Landsleuten dem deutschen Heldenlied einen höheren Rang zu als dem eigenen Nationalepos, dem Rolandslied.
Es ist ein Glücksfall, dass uns diese Werturteile über die beiden Nationalepen vorliegen, und zwar beide von französischer Seite. Der Unterschied zwischen ihnen ist historisch bedingt. Léon Gautier preist das Rolandslied [1], um mit dem Blick auf ein großes nationales Kulturdenkmal das durch den verlorenen Krieg von 1870/71 angeschlagene Selbstbewusstsein seiner Landleute aufzurichten. André Soutou geht es nach den zwei Weltkriegen, zu denen gerade das zugespitzte Nationalgefühl bei beiden Nationen geführt hat, um ein weiterführendes Anliegen. Er versteht das Nibelungenlied nicht nur als ein deutsches Epos, für ihn ist es ein Zeugnis europäischen Geistes, zu dem auch französisch-provençalischer Einfluss beigetragen hat. Um dieses Gedankens willen betont er die heiteren Seiten am jugendlichen Siegfried und lässt die düsteren der Tötungsakte und der Endkatastrophe außer Acht.
Soutous erzieherische Bemühungen richten sich im weltanschaulich konfusen Nachkriegsdeutschland auf ein übernationales Ziel: nämlich auf ein vereintes Europa, in dem die einst verfeindeten Nationen eine gemeinsame Heimat finden können. Was zu seiner Zeit noch eine schöne Hoffnung war, ist inzwischen erfreuliche Wirklichkeit geworden.
[1]
Der französische Text des Vortrags von André Soutou ist mit deutscher Übertragung abgedruckt in: Das Lied von gestern? Wormser Symposium zur Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes, Der Wormsgau, Beiheft 35, 1999, S. 83 ff., unter dem Titel „Entgermanisierung der Nibelungen – Ein rezeptionsgeschichtliches Kuriosum aus der französischen Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg“ von Erwin Martin
|