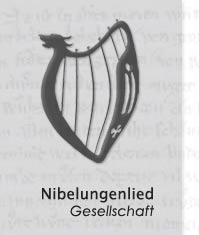|
|
|||||||
Zunächst muß ich mich dafür entschuldigen, daß mir das Zitat, das ich ursprünglich als Titel meines Vortrags gewählt hatte (und das auch noch im Programmheft steht1) im Laufe der Arbeit daran abhanden gekommen ist. Es schien so einfach und offensichtlich, mit dem zu beginnen, was Hebbel über Wagner und Wagner über Hebbel gesagt haben. Aber je mehr ich mich mit den biographischen Umständen beschäftigte, um so mehr drängte sich mir die einfache Erkenntnis in den Vordergrund, daß Biographie und Werk eines Künstlers praktisch nichts miteinander zu tun haben. Ich weiß natürlich, daß ich mich mit einer solchen Maxime nicht nur gegen den gut florierenden Biographien-Markt stelle, der von unsrer aller Neugier auf das Leben unsrer Nachbarn profitiert, sondern auch einem Klischee widerspreche, das sich in letzter Zeit durch permanente Wiederholung zu einem ästhetischen Dogma ausgewachsen hat: Daß man nur über etwas schreiben kann, was man selbst erlebt hat. Wir können alle von Glück sagen, daß diese Behauptung völliger Unfug ist! Man stelle sich nur vor, was wäre, wenn die tausende von Kriminalromanautoren, die Jahr für Jahr tausende von Kriminalromanen auf den Markt werfen, tatsächlich alle jemanden umgebracht hätten, nur um zu erfahren, wie man das beschreiben kann! Keiner von uns könnte ruhig über die Straße gehen, ohne fürchten zu müssen, von recherchierenden Thrillerautoren niedergemetzelt zu werden! Man kann also gar nicht entschieden genug betonen, daß Leben und Werk grundsätzlich zweierlei Ding sind. Hebbel selbst hat immer wieder betont, daß ein Dichter nicht verliebt sein müßte, um über Liebe zu schreiben, ebensowenig wie er betrunken sein müßte, um ein Trinklied zu schreiben. Wobei mir der Film Shakespeare in Love einfällt, einer dieser grauenvollen Biopics aus Hollywood, in denen künstlerische Inspiration gern mit sexueller Potenz gleichgesetzt wird und der Dichter seine besten Ideen immer hat, wenn er gerade auf seiner Madame liegt. Für diejenigen, die den Film gesehen haben, sei nur kurz darauf verwiesen, daß Shakespeare zu dem (mutmaßlichen) Zeitpunkt, als er Romeo und Julia schrieb, schon ca. zehn Jahre verheiratet und Vater von drei Kindern war, also schon die verschiedensten Stadien und Aspekte von Liebe kannte. Diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, haben auch nichts versäumt. Gerade auf den armen Shakespeare sind in den letzten 150 Jahren immer wieder philologische Attentate verübt worden, mit dem Ziel, ihm sein Werk zu entreißen und irgendwelchen interessanteren Aspiranten von Francis Bacon über Christopher Marlowe bis zu Königin Elisabeth herself unterzuschieben, und egal wie unsinnig diese Verfasserschaftstheorien auch sind und wie krass sie auch den offensichtlichen Tatsachen widersprechen, sie sind einfach nicht totzukriegen. Warum eigentlich? Einfach nur deshalb, weil das wenige, was wir sicher über Shakespeare wissen, ziemlich klar darauf hindeutet, daß er ein sehr langweiliger Mensch gewesen ist, der ein sehr langweiliges Leben geführt hat, und diejenigen, die an die Einheit von Leben und Werk glauben, einfach nicht akzeptieren wollen, daß man ein langweiliges Leben führen und trotzdem ein aufregendes Werk hinterlassen kann. Die Nibelungenliedforschung kann im Grunde froh sein, daß es bis heute nicht gelungen ist, den Dichter des Liedes namhaft zu machen. Wenn sich tatsächlich noch herausstellen sollte, daß er Geistlicher am Hofe des Bischofs von Passau gewesen ist, würde es sicher Leute geben, die das nicht wahrhaben wollen, weil sie erwarten, daß der Autor eines solchen Werkes mindestens an einem Kreuzzug teilgenommen und Jerusalem erobert haben muß. Letzten Endes interessiert uns das Nibelungenlied aber nicht wegen des Rätsels um seinen Verfasser, sondern weil hier ein unglaublich starker Stoff auf unglaublich starke Weise zu einem poetischen Werk umgeformt wurde, das auch heute noch Bearbeiter und Nachahmer anregt. Und damit bin ich, nach einer schon viel zu langen Abschweifung, wieder auf den Ausgangspunkt zurückgekommen, nämlich die Nibelungen-Dichtungen von Richard Wagner und Friedrich Hebbel, über die wir vorerst nichts weiter zu wissen brauchen, als daß sie beide im gleichen Jahr 1813 auf die Welt gekommen sind (und im Grunde ist das auch das einzige, das sie gemeinsam haben). Diejenigen, die dennoch Näheres über die biographischen Tangenten dieser beiden Autoren wissen wollen, verweise ich auf ein kleines Buch von Norbert Müller: Die Nibelungendichter Hebbel und Wagner, erschienen 1991, das detailliert alles (oder fast alles) Faktische aufführt, das sich zu diesem Thema finden läßt. Außerdem läuft im Nibelungenmuseum schon seit zwei Monaten eine sog. Medienpräsentation „Hebbel versus Wagner“, die ich leider vorab nicht sehen konnte, von der ich aber annehme und voraussetze, daß sie ebenfalls viel Biographisches enthält und mir damit die Mühe abnimmt, darauf einzugehen. Auf der Einladung, die ich zu besagter Präsentation erhalten habe, sieht es so aus, als würde Wagner Hebbel gerade einen Schwinger verpassen (und es genießen!). Was den rein äußerlichen Erfolg angeht, ist das sicher ein zutreffendes Bild. Gerade die Feierlichkeiten zu den jeweiligen 200. Geburtstagen haben gezeigt, um wieviel mehr Wagner im öffentlichen Bewußtsein verankert ist als Hebbel. Ich selbst komme dagegen, um im Boxer-Jargon zu bleiben, aus der Hebbel-Ecke. Ich kann mich als einer der zehn besten Hebbel-Experten weltweit bezeichnen, ohne deswegen des Größenwahns bezichtigt werden zu können, denn diese zehn Experten müsste man erstmal auftreiben. Bei Wagner wäre das Größenwahn, denn da scheinen die Experten so dicht gesät zu sein, daß ich damit rechnen muß, auch hier im Auditorium jemanden zu treffen, der sich in Wagners Werk besser auskennt als ich. Gegenüber diesen präsumtiven Wagner-Enthusiasten möchte ich nur kurz meine allgemeine Position vorausschicken: Ich bin musikwissenschaftlich nicht beschlagen genug, um Wagner von dieser Seite aus zu beurteilen, ich kann und will ihm also keinesfalls den ihm zugesprochenen Ruhm nehmen, daß er mit dem Tristan-Akkord die moderne Musik eingeleitet habe. Aber Wagner beansprucht für sich ja auch, mit seinen Opern-Texten als Dichter – unabhängig von der Musik – ernst genommen zu werden, und auf dem Gebiet fühle ich mich durchaus kompetent ein Urteil abzugeben. Und da muß ich sagen: Wagners Ring-Dichtung ist ein abschreckendes Beispiel dafür, wie man durch sprachliche Selbstverliebtheit, gedankliche Unklarheit und mangelndes Darstellungsvermögen einen der grandiosesten Stoffe der deutschen Literatur komplett ruinieren kann. Es gelingt Wagner zu keinem Zeitpunkt, die vielen logischen, psychologischen und metaphysischen Widersprüche in seinem Textbuch auch nur annähernd in den Griff zu bekommen. Theatralisch sind die vier Stücke sowieso eine einzige Katastrophe, und der Schluß des Ganzen ist schlichtweg sinnlos. Zusammengehalten wird der Ring ausschließlich von der Musik, und der Erfolg, den der Zyklus bis heute zu verzeichnen hat, ist nur sozialhistorisch und massenpsychologisch zu begreifen, ganz sicher nicht ästhetisch. Es ist einfach so, daß Unsinn, wenn er eine gewisse Größenordnung erreicht hat, immer imponierend auf die Menschen wirkt. Soviel nur zur Verständigung vorweg, damit hinterher niemand sagen kann, ich hätte ihn über meinen Standpunkt im Unklaren gelassen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, daß ein Thema mich sehr wenig interessiert, das im Zusammenhang mit Wagners 200. Geburtstag geradezu gebetsmühlenhaft abgehandelt wurde, nämlich sein Antisemitismus. Ich könnte natürlich leicht damit punkten, daß Hebbel während der Nazizeit nicht so tief in die braune Rezeption hineingezogen wurde wie Wagner, schon deshalb nicht, weil man ihm mit aller interpretatorischen Gewalt keinen Antisemitismus unterschieben konnte. Es ließ sich nämlich auch in der NS-Germanistik kaum ignorieren, daß Juden in Hebbels Bekanntenkreis einen prominenten Platz einnehmen. Er soll in einem antisemitischen Pamphlet einmal sogar selbst zu den Juden gerechnet worden sein, was er aber, als er davon erfuhr, eher als Kompliment denn als Beleidigung aufnahm. Bei der Wagner-Forschung bildet die Frage seines Antisemitismus dagegen einen eigenen Zweig, um nicht zu sagen, eine eigene Industrie, und auch in diesem Jubiläumsjahr sind wieder ganze Bücher zu diesem Thema erschienen. Ich frage mich allerdings, was es bringen soll, unter Aufwendung aller interpretatorischen, historischen, tiefenpsychologischen und poststrukturalistischen Mittel einem erklärten Antisemiten nachzuweisen, daß er Antisemit war. Ich hege den Verdacht, daß Viele dieses Thema nur zum Vorwand nehmen, um ihrem diffusen Unbehagen an Wagner, dem sie anders keinen Namen zu geben vermögen, Luft zu verschaffen. Ich denke, es gibt gute Gründe, bei Wagner Unbehagen zu empfinden, aber das sollte man dann auch rational und ästhetisch begründen können, nicht über den Umweg eines moralischen Fehlverhaltens. Intellektuelle Probleme moralisch auflösen zu wollen, führt nur zu selbstgerechtem Pharisäertum, frei nach Lukas 18,11: „Ich danke dir, Gott, daß ich nicht bin wie die anderen Leute …“ Daß Wagner Antisemit war, spricht so wenig gegen sein Werk, wie es für dasjenige Hebbels spricht, daß er keiner war. Aber bevor wir noch weiter ins Polemische hineingeraten, wenden wir uns zunächst zurück zu dem, auf das wir uns leichter werden verständigen können, zur faktischen Entstehungsgeschichte der beiden Nibelungendichtungen. Wenn wir die geistige Inkubationszeit einmal beiseite lassen, die natürlich bei jedem der beiden viele Jahre umfaßt, stellt sich der zeitliche Rahmen folgendermaßen dar: In den Jahren 1848 bis 1852 schreibt Wagner im Zürcher Exil den Text seiner Quadrologie, wobei er sich von hinten nach vorne durcharbeitet. Zuerst entsteht 1848 Siegfrieds Tod (die spätere Götterdämmerung), dann, weil er das Gefühl hat, daß die Handlung unverständlich ist, wenn er nicht die Vorgeschichte dazu bietet, folgt 1851 Der junge Siegfried (später Siegfried), dann als Vorgeschichte zur Vorgeschichte im Juni 1852 Die Walküre, und schließlich als Vorgeschichte zur Vorgeschichte zur Vorgeschichte im November 1852 Das Rheingold; eigentlich hätte er endlos so weitermachen können, denn auch das Rheingold beginnt ja mit einer umständlich erzählten Vorgeschichte, so daß wir im Endeffekt eine Einleitung haben, die drei Stücke mit elf Stunden Dauer umfaßt – die gigantischste Exposition der Literaturgeschichte! Wie dem auch sei, im Februar 1853 liest Wagner seine Textdichtung zum erstenmal öffentlich und gibt sie als Privatdruck für seine Freunde heraus. Dann erst beginnt die Komposition, diesmal in der richtigen Reihenfolge: November 1853–Januar 1854 Das Rheingold; Januar bis Dezember 1854 Die Walküre (die Partitur ist erst im März 1856 fertig), dann 1. und 2. Akt des Siegfried vom Sept. 1856 bis Juli 1857, der 3. Akt wird erst nach 8jähriger Unterbrechung (inzwischen hatte er Tristan und Isolde und die Meistersinger von Nürnberg geschrieben) im Juli 1865 weitergeführt und ist erst im August 1869 fertig, die Partitur im Februar 1871, Götterdämmerung wird von Januar 1870 bis November 1874 komponiert. Das Gesamtwerk wird bei den ersten Bayreuther Festspielen im August 1876 uraufgeführt. Die Gründe für die Unterbrechung der Arbeit in den Jahren 1857 bis 1865 sind nicht ganz klar. Vielleicht sind es pragmatische Gründe, weil Wagner einsehen mußte, daß ein Werk von solchen Dimensionen nicht aufführbar war, was sich erst änderte, als er ab 1865 die Protektion des Bayrischen Königs Ludwig gewann. Man kann sich allerdings auch vorstellen, daß er die inneren Widersprüche seiner Textdichtung nicht in den Griff bekam, was ihm dann bekanntlich erst unter Zuhilfenahme der Schopenhauerschen Philosophie gelang (oder, wie ich meine, nicht gelang). Hebbels Arbeit an seiner Nibelungen-Trilogie fällt fast genau in diesen Hiatus Wagners, so als ob der eine dem anderen die Staffel übergeben hätte (in Wahrheit wußten sie natürlich gar nichts voneinander, jedenfalls in der ersten Zeit nicht). Hebbels Tagebuch konstatiert den Beginn der Arbeit im Oktober 1855, Ende des Jahres sind schon zwei Akte fertig, von zehn geplanten. Die Arbeit wird unterbrochen durch das Hexameter-Epos Mutter und Kind und erst im Herbst 1856 wieder aufgenommen, jetzt mit veränderter Konzeption (5 lange Akte statt 10 kurzer). Wenig später, im Brief vom 21. November 1856 an Friedrich von Uechtritz heißt es dagegen: „Das Ganze gruppirt sich mir zu zwei Stücken, deren jedes selbständig seyn und drei, freilich große, Acte haben wird“. Am 18. Februar 1857 wird der Abschluß des ersten dieser beiden Teile gemeldet, nachdem er am 29. Dezember 1856 seiner Frau Christine und dem Freund und späteren Biographen Emil Kuh schon die ersten beiden Akte vorgelesen hatte. Dann wieder eine Unterbrechung durch Mutter und Kind, die Gesamtausgabe der Gedichte sowie das Drama Demetrius, von dem 1858 zwei Akte entstehen. Am 7. Dezember 1858 reicht Hebbel das fertige Stück Siegfrieds Tod bei Theaterdirektor Heinrich Laube ein, der eine Aufführung im Burgtheater aber ablehnt – nicht überraschend, wenn man weiß, daß Laube Hebbel nicht ausstehen konnte. Ein Gespräch mit dem Literaturhistoriker Hermann Hettner in Dresden im September 1859 regt Hebbel nach über zweijähriger Pause zur Fortsetzung der Arbeit an, und zwar derart plötzlich, daß er buchstäblich alles stehen und liegen läßt, um nur rasch nach Hause an seinen Schreibtisch zu kommen. Am 26. Oktober 1859 meldet das Tagebuch die Fertigstellung des 1. Akts von Kriemhilds Rache, und zum erstenmal ist jetzt von einer Trilogie die Rede. Am 13. November sendet Hebbel den Gehörnten Siegfried und Siegfrieds Tod in einer Abschrift an Franz Dingelstedt, damals Direktor des Hoftheaters Weimar. Von Kriemhilds Rache, jetzt von Anfang an auf fünf Akte berechnet, wird am 22. November der 2. Akt, am 17. Dezember der 3. Akt abgeschlossen. Der 4. Akt wird am 7. März, der 5. Akt und damit die Trilogie am 22. März 1860 fertiggestellt. Teile des Manuskripts liest Hebbel im Oktober 1860 in seiner Wohnung einem kleinen Kreis von Freunden vor, zum dem auch Franz Liszt gehört, der sich mit einer Improvisation auf dem Klavier bedankt, das sonst nur den Musikstunden von Hebbels Tochter vorbehalten ist. Das Werk wird 1861 durch Dingelstedt in Weimar uraufgeführt (der 1. und 2. Teil am 31. Januar, die gesamte Trilogie am 16. und 18. Mai). Dabei spielt Hebbels Frau Christine in Siegfrieds Tod die Brunhild, in Kriemhilds Rache die Kriemhild. Ihr ist auch die Druckausgabe gewidmet, die 1862 bei Hoffmann und Campe in Hamburg erscheint. Die Trilogie war der größte Theatererfolg in Hebbels Karriere. Bis zu seinem Tod am 13. Dezember 1863 wurde sie (oder zumindest die ersten beiden Stücke) aufgeführt in Berlin, Schwerin, Coburg, Brünn, Klagenfurt und Prag sowie – für Hebbel der größte Triumph – auch am Burgtheater in Wien, wo Direktor Heinrich Laube dem öffentlichen Druck schließlich nachgeben mußte. Im November 1863, vier Wochen vor seinem Tod, wird Hebbel für die Nibelungen der 1859 gestiftete, mit 1000 Talern dotierte Schillerpreis zugesprochen. Wie man sieht, hatte Hebbel zeitlich die Nase vorn, während Wagners Komposition noch ganz tief unten in der Schublade ruhte und es nicht danach aussah, als würde sie da herauskommen. Immerhin veröffentlichte Wagner Ende 1862, wenige Monate nachdem Hebbels Nibelungen im Druck erschienen waren, auch seinen Ring als Buch. Zweifellos wollte er damit seinen Anspruch auf den Stoff anmelden und darauf hinweisen, daß er auch noch da sei. Hebbel auf der anderen Seite wird Wagner bis zu diesem Moment gar nicht als Konkurrenz empfunden haben, denn als er an seiner Trilogie arbeitete, mußte er ganz andere Rivalen im Auge haben. Auch wenn wir heute nur noch Hebbels und Wagners Versionen kennen, war der Nibelungenstoff im 19. Jahrhundert brandaktuell und dementsprechend eine künstlerische Herausforderung für vielerlei Bearbeitungen. Ohne jetzt weiter auf die komplexe Nibelungen-Rezeption seit der Romantik einzugehen, erwähne ich nur kurz zwei dramatische Werke, die Hebbel gekannt hat: Da ist zum einen der 1828 uraufgeführte Nibelungenhort des im Vormärz sehr populären Berliner Theaterdichters Ernst von Raupach, der noch bis in die 1850er Jahre hinein auf allen deutschen Bühnen beheimatet war. 1847 sah Hebbel eine Aufführung in Wien und war zwar nicht von dem Stück, wohl aber von seiner Frau in der Rolle der Kriemhild begeistert. Zum anderen war da Emanuel Geibels Drama Brunhild von 1857. Geibel ist uns heute wohl nur noch durch sein Gedicht Der Mai ist gekommen und vielleicht auch noch in seiner travestierten Gestalt als Jean-Jacques Hoffstede aus den Buddenbrooks bekannt, aber zu dieser Zeit war er eine literarische Größe, die man ernst nehmen mußte, und Hebbel war denn auch durchaus besorgt, daß Geibel ihm den literarischen Lorbeer entwinden könnte. Nach einer Uraufführung der Geibelschen Brunhild in München erwies sich das Stück aber rasch als wenig bühnentauglich und hatte in direkter Konkurrenz zu Hebbels Trilogie keine Chance. Der Wagnerschen Rivalität war er sich erst relativ spät bewußt, jedenfalls nicht vor 1858, als er Franz Liszt in Weimar kennenlernte und durch ihn auch von Wagners Plänen erfuhr, und vermutlich auch, obwohl wir das nicht beweisen können, den Wagnerschen Text von ihm erhielt (der, wie erwähnt, bis Ende 1862 nur als Privatdruck existierte). Zu diesem Zeitpunkt war seine eigene Dramatisierung aber schon zu weit fortgeschritten, als daß Wagners Konzeption ihn noch irgendwie hätte beeinflussen können – ganz abgesehen davon, daß weder Hebbel noch Wagner zu denen gehören, die sich leicht beeinflussen lassen. Es bleibt also dabei, daß wir uns Wagners Ring des Nibelungen und Hebbels Nibelungen als unabhängig voneinander, aber gleichzeitig entstandene Bearbeitungen des gleichen Stoffs denken müssen. Und das macht es nur umso interessanter, sie miteinander zu vergleichen. Was das rein Stoffliche betrifft, sind die Unterschiede deutlich genug. Hebbel hält sich eng an das Nibelungenlied, er fängt an, wo es anfängt und hört auf, wo es aufhört und übernimmt manchmal fast wörtlich die Dialoge. Er selbst hat behauptet, er habe nur der „Dolmetsch eines Höheren“ – will sagen des Nibelungenlied-Dichters – sein wollen, er habe eine altes Bild von den Spinnweben befreien, ein verrostetes Uhrwerk wieder neu aufziehen wollen, und was dergleichen Metaphern mehr sind, die man getrost als klassische Bescheidenheits-Phrasen abtun kann. Denn ganz sicher ist Hebbels Arbeit mehr als die eines Philologen, der aus einem korrumpiert überlieferten Text die ursprüngliche Fassung wiederherzustellen versucht. Auch wenn seine Eingriffe in den Text relativ subtiler Natur sind, sind sie doch signifikant genug, um aus dem Ganzen 100 % Hebbel zu machen. In einer ungedruckt gebliebenen Vorrede zur Buchausgabe von 1862 hat Hebbel seinen Ansatz seinem mittelalterlichen Vorgänger sozusagen in den Mund gelegt: „Es ist nämlich gar nicht genug zu bewundern“, heißt es da, „mit welcher künstlerischen Weisheit der große Dichter [der Nibelungenlied-Dichter] den mystischen Hintergrund seines Gedichts von der Menschen-Welt, die doch bei oberflächlicher Betrachtung ganz darin verstrickt scheint, abzuschneiden gewußt, und wie er dem menschlichen Handeln trotz des bunten Gewimmels von verlockenden Riesen und Zwergen, Nornen und Valkyrien seine volle Freiheit zu wahren verstanden hat“ (W 13, 338). Man kann nicht umhin zu denken, daß Hebbel sich hier auf den Text von Wagners Ring-Dichtung bezieht, denn bei dem wimmelt es ja von Riesen und Zwergen, Nornen und Walküren, und bei ihm ist diese mythische Welt eben nicht klar von der Menschenwelt getrennt, und es wird geradezu zum Hauptproblem bei Wagner, daß das Handeln der Menschen eben nicht frei ist, sondern bis zum Schluß determiniert durch die Aktionen der Götter und sonstigen mythischen Wesen. Die ersten drei Stücke der Wagnerschen Quadrologie stecken noch bis zum Hals in diesem mythischen Halbdunkel und bedienen sich weit mehr bei der Edda, die 1851 in Karl Simrocks Ausgabe erschienen war, als beim Nibelungenlied. In Eine Mitteilung an meine Freunde sagt Wagner ausdrücklich, daß erst die Beschäftigung mit dem nordischen Sagenkreis ihn dazu inspiriert habe, Siegfried „zum Helden eines Dramas zu machen, was mir nie eingefallen war, solange ich ihn nur aus dem mittelalterlichen Nibelungenliede kannte.“ Das Problem dabei ist allerdings, daß diese eddischen Dichtungen auf einer Vielzahl von Skaldendichtungen beruhen und kein in sich konsistentes Ganzes bilden. Der Hauptautor ist der Isländer Snorri Sturluson, der im 13. Jahrhundert lebte und selbst schon Christ war, an seinem Gegenstand also ein mehr antiquarisches Interesse hatte. Es ist in der Forschung heftig umstritten, ob und inwieweit er die Göttergeschichten korrekt wiedergibt. Auf jeden Fall hatte er zu ihnen sicher kein ungebrochenes Verhältnis mehr. Und nun kommt Wagner und transponiert das Ganze in seine Zeit, wodurch es zu einer nochmaligen Brechung kommt, und dabei oft genug ins unfreiwillig Komische verrutscht. Daß z. B. Odin resp. Wotan die Göttin Freya als Pfand einsetzt, um den Bau von Walhall zu finanzieren, womit die eigentliche Handlung bei Wagner beginnt, erscheint auf den ersten Blick völlig absurd – ein Gott, der seine eigene Hütte nicht bezahlen kann! – ist aber tatsächlich schon bei Snorri überliefert. Die Frage einmal beiseite gelassen, ob Snorri das eventuell schon ironisch meint, bekommt das Motiv bei Wagner einen Zug ins Kleinbürgerliche: Frigga hat den Bau von Walhall angeregt, damit Wotan endlich mal zuhause bleibt, und Wotan hat nachgegeben, um die quengelnde Gattin zu beruhigen und umso leichter seinen Streifzügen nachgehen zu können. Erinnert das nicht an die Boulevardkomödien der Kaiserzeit, in denen der brave Familienvater gern mal einen draufmachen möchte und sich irgendwelche Lügengeschichten ausdenkt, um das vor seiner Frau geheim zu halten? Willy Millowitsch hat diese lüsternen Spießer früher unnachahmlich gespielt (z. B. in Die spanische Fliege von Arnold und Bach), und den könnte ich mir auch ganz gut als Wagnerschen Wotan denken. Erst in der Götterdämmerung ist Wagner beim Stoff des Nibelungenliedes angekommen und geht jetzt von der Handlung her ungefähr parallel mit Hebbels Siegfrieds Tod. Aber auch hier tummeln sich im Hintergrund noch mythische Wesen, die bei Hebbel nichts mehr verloren haben, auch hier wird noch ein Zug aus dem ursprünglichen Sagenkreis übernommen, den der Nibelungenlied-Dichter (worauf Hebbel in seiner Vorrede ausdrücklich hinweist) wohlweislich nicht übernommen hatte, nämlich den Zaubertrank, durch den Siegfried Brunhild vergißt. Dieses Motiv zeigt deutlicher als alles andere, warum Wagner letztendlich künstlerisch gescheitert ist: Eben weil er Zaubertränke, Flüche, Zauberringe und dergleichen magischer Accessoires braucht, um die Handlungen seiner Figuren zu motivieren, bleiben sie bis zum Schluß gefangen in dem deterministischen Netzwerk, das der Autor für sie gesponnen hat, sie erlangen bis zum Schluß nicht die Freiheit in ihren Entscheidungen, die es für den Leser und Zuschauer braucht, um sie als reale Imaginationen eines poetischen Weltbildes ernst zu nehmen. In einem dramatischen Text muß es dem Autor gelingen die Illusion zu erzeugen, daß die Figuren auch ohne ihn bestehen können, daß sie sozusagen naturwüchsig sind und daß die Schauspieler, die sie darstellen, keine Schauspieler, sondern quasi Wiedergeburten ihres Geistes sind. Das gelingt Hebbel leicht, Wagner dagegen gar nicht, bei ihm bleiben die Figuren immer Marionetten, die mit ihren Fäden an den Fingerspitzen ihres Schöpfers hängen. Ihre Handlungen sind derart determiniert, daß sie selber nicht wissen, was sie tun, und auch den Rezipienten – also uns! – nicht begreiflich machen können, warum sie tun was sie tun. Determinismus, das ist das entscheidende Stichwort, wenn es um Wagners Konzeption geht. Unfrei in ihren Handlungen sind alle seine Figuren schon von Beginn an, und bleiben es auch, unfrei durch Runen, Verträge, Flüche. Anscheinend steht ja die Suche Wotans nach dem einen freien Helden im Mittelpunkt, der durch seine freie Tat die schon fest in ihren eigenen Schlingen gefangene Götterwelt wieder befreien und – mit Hebbels Etzel zu sprechen – die Welt auf seinem Rücken weiterschleppen soll. Allerdings erweisen sich die Aspiranten für die Heldenrolle alle als unfrei, nicht nur Siegmund, sondern auch sein Sohn Siegfried, obwohl der doch zunächst soziopathisch genug auftritt, um für frei gelten zu können. Aber auch der ist in jeder seiner Taten ferngesteuert. Ob er sein Schwert schmiedet oder Fafner erschlägt oder Brünnhilde aus dem Schlaf erweckt – er tut immer genau das, was das Schicksal für ihn schon seit langem bereitgehalten hat. Welche Art von Schicksal ist das aber genau, das Siegfried und alle anderen Figuren leitet? Es ist offensichtlich nicht das antike Fatum, denn wo könnte es ein Fatum geben, wenn die Götter selbst nur durch Verträge herrschen. Ebensowenig ist es natürlich das mittelalterliche Gottesgericht, denn ein monotheistischer Gott als Pantokrator ist weit und breit nicht in Sicht. Das neuzeitliche Charakterdrama ist es auch nicht, denn diese Figuren haben ja nicht mal ansatzweise Charakter, der sie zu der einen oder anderen Tat drängen könnte. Eine soziale Tragödie wird hier auch nicht gespielt, denn wo wäre die Gesellschaft, die mit ihren Regeln sozialen Druck auf die Handelnden ausüben könnte? Keine Kraft ist erkennbar, die diese Gestalten lenkt, und doch werden sie gelenkt. Ihre Leidenschaften sind alle nicht selbst-induziert, sie werden ihnen nur von außen aufgepfropft, aber von wem? Die Antwort lautet: Es ist der Mythos, der die Handlung bestimmt. Und was ist der Mythos? Die ursprüngliche Bedeutung von Mythos lautet: Erzählungen von Göttern und Helden, in denen die Erfahrungen von Generationen gespeichert und poetisch wiedergegeben werden. In der Moderne dagegen wird das Wort Mythos immer als Signal benutzt, sein Gehirn auszuschalten und sich in diffuse Irrationalität einzuwickeln. Das Wort Mythos wird heutzutage in einer geradezu unglaublichen Bandbreite benutzt, aber tatsächlich haben wir keinen Mythos, weil wir nicht mehr das kollektive Bewußtsein haben, das vormoderne Gesellschaften hatten und das Voraussetzung für einen echten Mythos ist, in dem Erfahrungen als überzeitlich und überindividuell anerkannt und in Bildern und Geschichten ausgedrückt werden, die als absolute Wirklichkeit gelten, nicht bloß als Interpretation von Wirklichkeit, wie für uns. Alles was wir noch haben, sind Privatmythen – davon allerdings tausende, die im Dunstkreis zwischen Fußballclubs und Popstars hin- und herwimmeln wie die sprichwörtlichen Mücken im Licht und uns nebenbei auch die ganze Produktpalette von Sammelstickern, Fan-T-Shirts bis zu Massen-Conventions und Facebook-Accounts anbieten, ein Mythos-Merchandising, an dem mit Sicherheit immer irgendjemand verdient. Und Wagner ist einer der ersten Privatmythologisten, man könnte sogar behaupten, er ist der Gründervater dieser Bewegung. Sein Nibelungen-Mythos ist ein reiner Privatmythos, er koppelt sich völlig ab von all den vorhergehenden Nibelungen-Dichtungen, er will, wie er selbst sagt, „auf den Grund des alten urdeutschen Mythos“ kommen und darin den wahren Menschen oder das Reinmenschliche finden, abgelöst von allen (historischen oder sozialen) Verhältnissen (Mitteilung an meine Freunde Loc. 1860–1874). Diese Suche nach dem Urgrund und Ur-Ding ist typisch für das 19. Jahrhundert. Goethe suchte die Urpflanze, Darwin den Ursprung des Lebens, die Entdecker des Archäopteryx den Urvogel, die Entdecker des Neandertaler den Urmenschen, die Historiker den ersten Deutschen und Karl Lachmann und seine Schule von Texteditoren die Urdichtung, die den verschiedenen überlieferten Handschriften (etwa des Nibelungenliedes) zugrunde läge. Heute wird man schon im Proseminar Mediävistik davor gewarnt, nach einer Ur-Dichtung zu suchen, die es aller Wahrscheinlichkeit nach nie gegeben hat. Das Nibelungenlied, die Edda und die Thidreks-Saga als Hauptvertreter dieses Stoffkreises sind in ihrer überlieferten Form alle mehr oder weniger im 13. Jahrhundert entstanden, repräsentieren aber völlig unterschiedliche Traditionslinien aus unterschiedlichen Sprachkreisen, unterschiedlichen historischen Situationen und unterschiedlichen kulturellen Entwicklungsstufen, die sich untereinander gar nicht berühren und auch in keinem gemeinsamen Ur-Nibelungenlied wurzeln. Man sollte sich den ganzen Stoffkreis eher wie ein Fluidum denken, das diese Kultur ungreifbar durchströmt, und nur konkrete Gestalt annimmt, wenn sie von einem konkreten Autor für konkrete Zwecke in eine konkrete Form gegossen wird. Wenn also Wagner meint, er habe den deutschen Ur-Mythos „in seiner keuschesten Schönheit“ gefunden, dann hat er sich von den Denkmustern seiner Zeit auf den Holzweg locken lassen, der ihn in die völlige Ent-Wirklichung seiner Dichtung führte. D. h. weil er die Figuren für zeitlos hält – was sie aber nicht sind! – transponiert er sie aus ihrer in unsere Zeit, wo sie wie die Travestie ihrer selbst wirken. Sie haben keinerlei Bezug zur Realität mehr und existieren nur noch in der Scheinwirklichkeit des Privatmythos, sie unterliegen den Regeln dieser Privatwelt, ihre Psychologie ist nur in dieser Welt denkbar, ihre Motive können sie nur aus der Logik dieser Welt schöpfen, ihre Handlungen machen nur hier Sinn, und ihr Schicksal ist ihnen einzig und allein vom Schöpfer dieser Welt aufdiktiert – also von Wagner selbst. Das erklärt das Sprunghafte in der Motivierung der Handlung und der Figuren, denen immer zur rechten Zeit gerade das wiederfährt, was nötig ist, um die Handlung über einen toten Punkt hinwegzubringen. Wenn z. B. Siegmund sich waffenlos im Haus eines Feindes wiederfindet, erwähnt er eine Prophezeiung seines Vaters, daß er in höchster Not ein Schwert finden werde, mit dem er sich verteidigen könne, und prompt weist ihn Sieglinde unter wildem gestischen Gefuchtel und Augenrollen auf das im Baumstamm steckende Schwert hin, das sich in handlicher Griffweite befindet (der König-Artus-Mythos grüßt von fern). Wenn Wotan aka. der Wanderer Mime prophezeit, daß nur jemand, der die Furcht nicht kennt das zerbrochene Nothung wieder zusammenschmieden könne, dann kommt im nächsten Moment Siegfried hereingestürmt und jammert darüber, daß er die Furcht nicht kenne und daß er jetzt doch bitte ein Schwert haben wolle. Und wenn dann Gunter, Hagen und Brünnhilde die Köpfe zusammenstecken, um Siegfried zu ermorden, erzählt Brünnhilde von dem praktischen Umstand, daß Siegfried am Rücken verwundbar ist, weil sie ihn nur vornerum unverwundbar gemacht hätte. Daß er überhaupt unverwundbar ist, wurde bis dahin gar nicht erwähnt, noch viel weniger, daß das auf Brünnhildes magische Fähigkeiten zurückgeht. Warum kommt erst jetzt die Sprache darauf? Der Drache wurde erschlagen (sogar auf offener Bühne), ohne daß Siegfried Gelegenheit erhielt, sich in seinem Blut zu baden. Erst jetzt, da er selbst erschlagen werden soll, wird das Motiv gebraucht, und erst jetzt wird es eingeführt. Daß das mythische Bild vom Bad im Drachenblut und dem Lindenblatt, das Siegfried verwundbar macht, im Grunde ungleich tiefer, vielschichtiger und aussagekräftiger ist und eigentlich gar nicht besser erfunden werden kann, entgeht Wagner dabei völlig, vermutlich, weil er viel zu sehr in seinen eigenen Privatmythos verliebt ist, als daß er der Weisheit des echten Mythos zugänglich wäre. Am Schluß der Götterdämmerung tritt dann die völlige Vernunftdämmerung ein. Gutrune und Hagen verwandeln sich in Kleiderständer und stehen still und stumm in der Gegend rum, einfach weil sie für die Handlung nicht mehr gebraucht werden, und lassen Brünnhilde ihren ellenlangen selbstgerechten Klagegesang auf Siegfried abspulen, als ob sie nicht selbst aktiv an seiner Ermordung beteiligt gewesen wäre. Wieso und warum die finale indische Witwenverbrennung samt Pferd dann die Erlösung der Welt bedeuten sollte, und wie es kommt, daß sich an diesem doch recht weit von Asgard entfernten Scheiterhaufen Walhall entzündet, auch wenn man bedenkt, daß der zu handlichen Briketts zersägte Weltenbaum dort schon fürs letale Zündeln bereit liegt, das erschließt sich unter keiner wie auch immer gearteten Logik, das macht nicht einmal innerhalb des Wagnerschen Privatmythos auch nur den leisesten Anflug von Sinn. Auch hier der Hinweis auf den echten Mythos von der Ragnarök, die in der Form, wie sie die Völuspa und die Prosa-Edda überliefert, ungleich poetischer, tiefsinniger und in sich stimmiger ausfällt. Einer der Hauptbestandteile des Wagnerschen Privatmythos ist ja der titelgebende Ring und der Fluch des Alberich, mit dem er kontaminiert ist. Um Habgier und Neid, Angst und Sorge geht es in diesem Fluch, der jeden Besitzer treffen soll. Aber der nächste Besitzer, Fafner, verschwindet erst einmal für dreieinhalbtausend Verse aus der Handlung, und Siegfried, der ihm dann den Ring aus den kalten toten Klauen abnimmt, ist offensichtlich ebenso wie Brünnhilde, der er ihn schenkt, völlig immun gegen die Wirkung von Alberichs Fluch. Hagen und Gunther erscheinen in der Götterdämmerung in der Tat neidisch, habgierig und ruhmsüchtig. Sie sind das allerdings auch von Anfang an, lange bevor sie überhaupt etwas vom Ring hören oder wissen. Was die Handlung quer durch die vier Stücke ständig vorantreibt, sind die seltsamen Pläne Wotans, sich durch inzestuöse Selbstbefruchtung von sich selbst zu verabschieden, nicht der Fluch des Alberich. Der Ring also, nach dem die ganz Quadrologie ja immerhin benannt ist, hat kaum etwas mit der Handlung zu tun, er ist als Dingsymbol völlig impotent. Und wenn man darüber nachdenkt: Warum sollte ausgerechnet der Fluch eines notgeilen Zwergs die Handlungen oder Schicksale von Göttern, Riesen und Menschen determinieren können? Welche Kraft, die ja größer sein müßte als die aller lebenden Wesen, sollte in einem solchen Fluch wirksam werden, und wieso sollte ausgerechnet Alberich diese Kraft entfesseln können? Schon Schiller hat man dieses Motiv in seiner Braut von Messina nicht mehr so recht abgenommen, und da ging es nur um einen Familienfluch, nicht wie bei Wagner um einen Menschheitsfluch. „Wir sind“, schreibt Hebbel in seiner Rezension des Schillerschen Stücks, „darüber hinaus, dem Fluch, den ein Individuum gegen das andere ausstößt, und wäre es auch im Verhältniß von Vater und Sohn, eine magische, die höchste Macht zwingende und ihr die Execution abdringende Kraft beizulegen, wir sehen in einem solchen Fluch nur noch den leidenschaftlichen Ausdruck eines gerechten oder ungerechten Zorns, der realisirt werden mag, wenn der Verfluchte es an und für sich verdient, wenn es also auch ohne den Fluch geschähe, der aber mit Vernunft und Gefühl in Widerspruch tritt, wenn er an und für sich (…) etwas bedeuten und für das sittliche Gesetz, dem er, wie es z. B. in der Racineschen Phädra offenbar der Fall ist, geradezu entgegengesetzt seyn kann, in die Stelle treten will. Das Individuum ist emancipirt, daraus folgt unter Anderem auch, daß mit jedem eine neue Welt, ein unendlicher Lebens- und Thaten-Kreis beginnt, der nicht willkürlich, um den Rache-Durst eines anderen Individuums zu befriedigen, abgeschlossen und unterbrochen werden darf, sondern sich durch sich selbst vernichten muß; darum thut, um auch hierin an die Weisheit Shakespeares zu erinnern, sich die Erde nicht auf, als Lear seine Töchter verflucht, um sie zu verschlingen, sondern es wird uns veranschaulicht, wie sich in ihnen, in Folge der ersten und größten, Sünde nach Sünde entbindet und wie sie dadurch ihren Untergang finden“ (Tagebuch 9. April 1844). Der Fluch steht also als Handlungsmotiv in keinem Zusammenhang mehr mit der Lebenswirklichkeit des 19. – und erst recht nicht des 21. – Jahrhunderts. Er hat auch keine Auswirkungen auf die Handlungen des Personals der Quadrologie, auch wenn Wagner das behauptet. Er existiert nur noch als literarische Konvention, und als solches wird er herbeizitiert, wie Wagners Ring-Dichtung überhaupt nur ein einziges Konglomerat aus Zitaten ist (von den Artus-Sagen bis zu Grimms Märchen), die derart ungeschickt zusammengeflickt werden, daß man wie bei Frankensteins Monster überall die Schrauben, Drähte und Nahtstellen sieht. In dieser Hinsicht ist Wagner der Großvater der modernen Fantasy-Literatur, die sich ja mit derselben eklektischen Sammelwut bei den Mythen dieser Welt bedient. Was allein Tolkien in seinem Herrn der Ringe alles von Wagner übernommen hat (inklusive Gandalfs Schlapphut), könnte schon wieder einen eigenen Vortrag füllen. Und wie alle diese Bücher ist auch Wagners Ring eine rein selbstbezügliche Literatur, sie ist Literatur aus Literatur, ohne Rückbezug auf irgendeine außerliterarische Wirklichkeit, so wie die modernen Vampirromane sich nur auf die Konventionen älterer Vampirromane (und –filme) stützen, nicht auf Wirklichkeit. Der Mythos, das ist bei Wagner der Rückzug aus der Wirklichkeit ins wirre Traumreich schopenhauerisierender Erlösungsfantasien. Im Gegensatz dazu will Hebbel, wie er in der oben zitierten Vorrede klar zum Ausdruck bringt, das Mythische ins Rationale übersetzen. „Mir scheint“, notiert er in Bezug auf die Nibelungen in sein Tagebuch, „daß auf dem vom Gegenstand unzertrennlichen mythischen Fundament eine rein menschliche, in allen ihren Motiven natürliche Tragödie errichtet werden kann und daß ich sie, so weit meine Kräfte reichen, errichtet habe. Der Mysticismus des Hintergrunds soll höchstens daran erinnern, daß in dem Gedicht nicht die Secunden-Uhr, die das Daseyn der Mücken und Ameisen abmißt, sondern nur die Stunden-Uhr schlägt“ (Tagebuch 14. August 1861). Gemäß dieser Grundmaxime pflanzt er den mittelalterlichen Figuren eine neuzeitliche Psychologie ein (soweit das überhaupt möglich ist) und drängt alles Mythische soweit wie möglich zurück. Selbst noch unmittelbar vor der Drucklegung 1862 strich er einige Passagen, auf die er ursprünglich sehr stolz gewesen war, die dann aber doch zu sehr in die Richtung einer Privatmythologie gingen, und die sich jetzt nur noch im kritischen Apparat finden. Zusätzlich unterlegt er seiner Bearbeitung einen geschichtlichen Rahmen, indem er die Handlung historisch sehr konkret in die Phase des Übergangs vom Heidentum zum Christentum verortet – nicht im Sinne einer christlichen Apotheose, die den Sieg des Christentums feiern würde. Das Neue siegt nicht über das Alte, sondern das Alte vernichtet sich selbst und macht Platz für das Neue. In diesem Rahmen sind Siegfried und Brunhild mit ihrem eindeutig mythischen Hintergrund, den auch Hebbel nicht ausmerzen konnte, die „letzten Riesen“, wie sie an einer Stelle genannt werden, d. h. die letzten Wesen einer mythischen Welt, die in der historischen Welt der Menschen verloren und deplatziert wirken und notwendig darin untergehen müssen, weil sie die Gesetze und Gefahren dieser neuen und für sie fremden Welt nicht begreifen. Dabei hat sich Siegfried eigentlich schon aus seinen mythischen Zusammenhängen befreit. Gleich im Vorspiel Der gehörnte Siegfried erzählt er an Gunters Hof von seinen Abenteuern mit Balmung und Tarnkappe, Drache und Alberich, die alle noch ins Reich des Mythos gehören und deshalb auch nur episch wiedergegeben werden. Schließlich berichtet er auch, wie er nach Isenland zu Brunhild kommt und den Feuerring durchschreitet, genau wie Wagner es in Siegfried beschreibt. Dann aber der entscheidende Unterschied: Hebbels Siegfried folgt nicht seiner mythischen Bestimmung, er nimmt nicht die Tarnkappe ab und offenbart sich Brunhild, sondern kehrt um: „Denn Brunhild rührte, wie sie droben stand, / In aller ihrer Schönheit nicht mein Herz, / Und wer da fühlt, daß er nicht werben kann, / Der grüßt auch nicht“ (Vers 647–650). Er folgt also, anders als Wagners Siegfried, nicht dem, was die göttliche Prädestination für ihn vorgesehen hat, sondern seinem individuellen Gefühl, etwas, das im Mythos eigentlich gar nicht existiert. Mit dieser Verweigerung, der zugleich der erste Akt der Willensfreiheit für Siegfried ist, durchbricht er den Kreis des Mythos für immer und findet sich in einer neuen fremden Welt wieder, und alles, was er dann tun wird, tut er aus dem Zwiespalt eines, der in eine Welt geraten ist, für die er nicht gemacht war. Brunhild auf der anderen Seite verläßt nicht freiwillig die mythische Welt, sie wird gewaltsam daraus gerissen, und ist deshalb auch unfähig sich adäquat in der neuen zu benehmen. Sie folgt auch weiterhin ihrer mythischen „Programmierung“ (wenn man das so nennen darf), und die treibt sie unweigerlich zu Siegfried. Und wenn sie ihn nicht haben kann, muß sie ihn vernichten. Bis zum bitteren Ende folgt sie dieser mythischen Logik und verschwindet dann wieder ins Halbdunkel einer vormodernen Zeit, die sich nicht in die Moderne integrieren lassen wollte und konnte. Das ist ein – zugegebenerweise sehr verknapptes – Beispiel dafür, wie Hebbel die mythischen Elemente in die moderne Rationalität überträgt, ohne gleich in den Sumpf des Privatmythos zu versinken. Besonders bewundernswert finde ich dabei die absolute Objektivität seiner Darstellungsweise, die man kaum bei einem anderen Autor so ausgeprägt findet. Soll heißen, wenn er sich in eine Figur vertieft, dann ist er immer ganz und gar bei dieser Figur und auf ihrer Seite. Er ist immer völlig auf Siegfrieds Seite, wenn er einen Dialog Siegfrieds schreibt, und absolut auf Hagens Seite, wenn er Hagen schreibt. „Ein Charakter“, heißt es dazu im Tagebuch, „handle und spreche nie über seine Welt hinaus, aber für das, was in seiner Welt möglich ist, finde er die reinste Form und den edelsten Ausdruck, selbst der Bauer.“ Selbst für Nebenfiguren, die nur einen Auftritt haben, versucht er diesen edelsten Ausdruck zu finden und ihrem Charakter trotz aller gebotenen Kürze einen möglichst treffenden Ausdruck zu geben. Ute und Frigga, Giselher und Gerenot, Volker und Dankwart sind von ihrer Funktion her eigentlich nicht viel mehr als Stichwortgeber, aber Hebbel bedenkt sie mit der gleichen Aufmerksamkeit wie die Hauptfiguren und gibt jedem einen individuellen Umriß. Bei Wagner schaffen sie’s nicht einmal ins Personenverzeichnis, weil der sich immer nur für seine Erlöserfiguren interessiert und alle anderen nur als Staffage und Spruchband-Halter behandelt, die nach Gebrauch wieder vergessen werden konnten. Auf Leser, die es gern eindeutig haben, wirkt diese Plakativität sicher anziehender als die irritierende Hebbelsche Objektivität, bei der man nie genau sagen kann, auf wessen Seite der Autor eigentlich steht, so daß man manchmal den Eindruck hat, er würde für die Falschen Partei ergreifen. Hebbels Ideal war aber ein Drama, in dem Alle recht haben, es also keine Falschen und keine Bösen im eigentlichen Sinne gibt. Gerade darin lag für ihn die menschliche Tragik, daß Alle sich im Recht glauben und erst indem sie ihr vermeintliches Recht behaupten wollen, Unrecht tun. Wagners Dramaturgie ist gekennzeichnet durch lange Szenen, die blockhaft aneinandergefügt werden, in denen selten mehr als zwei oder drei Personen auftreten und einer gewöhnlich das Wort führt und halbstundenlang singend erklärt, warum er tut was er tut oder nicht tun kann was er gern tun würde oder irgendwann mal tun wird, wenn nur die Welt nicht so wäre wie sie ist. Da wird jede Handlung oder nur der Ansatz einer Handlung zerredet und zergliedert und noch und nöcher durchgekaut, was besonders in der Walküre auffällt: Von den vier Stunden Aufführungsdauer dieses Stücks fällt ungefähr eine Stunde auf reine Handlung, die restlichen drei Stunden wird kommentiert und reflektiert und diskutiert und disputiert, was richtig wäre und warum man leider trotzdem das Falsche tun müsse. In seinen frühen Stücken hat Hebbel auch häufig den Fehler gemacht, die Handlung mit Reflexion zu überfrachten, aber davon hat er sich in seinem letzten Lebensjahrzehnt ganz frei gemacht. In der Nibelungen-Trilogie ist er auf dem absoluten Höhepunkt seiner Kunst und schafft es, einen an sich epischen Stoff fast ganz in dramatische Struktur aufzulösen, das heißt, eine Handlung zu erschaffen, die aus einem unglaublich komplexen Gefüge verschiedenster, gegeneinander arbeitender Kräfte besteht und doch unaufhörlich und unaufhaltbar vorwärts drängt. „Der Dualismus“, heißt es 1840 im Tagebuch, „geht durch alle uns’re Anschauungen und Gedanken, durch jedes einzelne Moment unseres Seyns hindurch und er selbst ist uns’re höchste, letzte Idee. Wir haben ganz und gar außer ihm keine Grund-Idee. Leben und Tod, Krankheit und Gesundheit, Zeit und Ewigkeit, wie Eins sich gegen das Andere abschattet, können wir uns denken und vorstellen, aber nicht das, was als Gemeinsames, Lösendes und Versöhnendes hinter diesen gespaltenen Zweiheiten liegt“ (Tagebuch 2. Dezember 1840).l In diesem Sinne einer dualistisch gespaltenen Welt, deren Einheit uns verborgen bleibt, folgt bei Hebbel auf jede Aktion eine Reaktion, jede Kraft hat ihre Gegenkraft, jeder Wille einen Gegenwillen, jedes Licht wirft Schatten, jede Tugend hat ihre dunkle Seite. Aus Liebe wird Hass, aus Glück wird Überheblichkeit, aus Staatsräson Mord, aus Neid Verrat, aus Treue Untreue, Ruhmsucht führt zu Demütigung, Rationalität zu Wahnsinn und die Suche nach Gerechtigkeit endet in einem Blutbad. Das alles ist so subtil ineinander geschoben, daß jede Szene einen neuen Aspekt offenbart und jeder Dialog ein neues Verhältnis beginnt, so wie kein Konflikt gelöst wird, ohne daß ein neuer sich eröffnet. Um abschließend nur ein Beispiel zu nennen, sei auf die Szene aus dem 2. Akt (3. Szene) von Siegfrieds Tod verwiesen (die, wenn auch gekürzt, in Dieter Wedels Inszenierung enthalten ist), wenn Giselher den Vermittler zwischen Siegfried und seiner Schwester Kriemhild macht, eine wunderbar leichte, fast komödiantische Szene, die einen hellen Kontrast zu dem düsteren Grundcharakter des Ganzen herstellt und diesen dadurch nur noch mehr betont. Giselher ist der kleine Bruder in der burgundischen Königsfamilie, den niemand so richtig ernst nimmt – auch die meisten Bearbeiter des Nibelungenstoffs wußten mit ihm nicht viel anzufangen. Für Hebbel aber gibt es, wie gesagt, keine unwichtigen Figuren, er nutzt Giselher, um das Verhalten der Hauptfiguren in ihm und durch ihn zu reflektieren. Siegfried und Giselher sind beide naive Charaktere, aber die Naivität Giselhers ist aufrichtig und offen, er liebt alles und jeden und verbandelt Siegfried und Kriemhild spielerisch, indem er sich über ihre Schüchternheit und Unbeholfenheit lustig macht. Die Naivität Siegfrieds dagegen ist gefährlich, denn wer mit einer solchen Macht ausgestattet ist, darf nicht so naiv sein, und darin liegt ein Teil seiner Tragik. Seine Naivität ist unverantwortlich, er verschachert Brunhild an Gunter, um selbst an Kriemhild zu kommen, wie ein Kind, das ein Spielzeug haben will, und ein anderes dafür kaputtmacht. So wird er in aller Naivität schuldig. Das muß als Beispiel dafür genügen, wie differenziert Hebbel die dramatischen Kräfte gegeneinander austariert, wie überlegt und überlegen er das riesige Ensemble steuert und wie souverän er die gigantische Stoffmasse von der ersten bis zur letzten Szene beherrscht. |
|||||||